Der heilige Weg zum Falkenstein, Essay von Alexander Lernet-Holenia (1959)
Erschienen in: In: Merian, Heft 5 / VII, 1959, S. 23
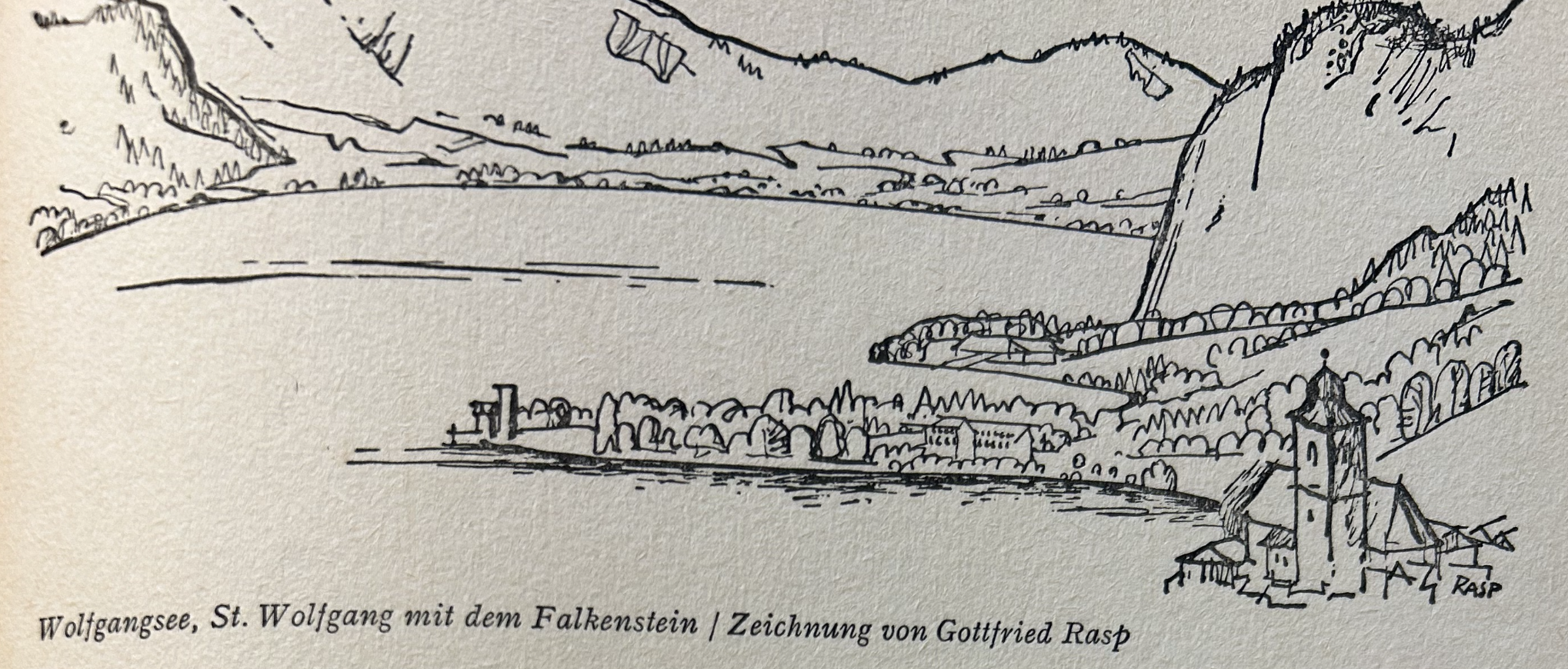
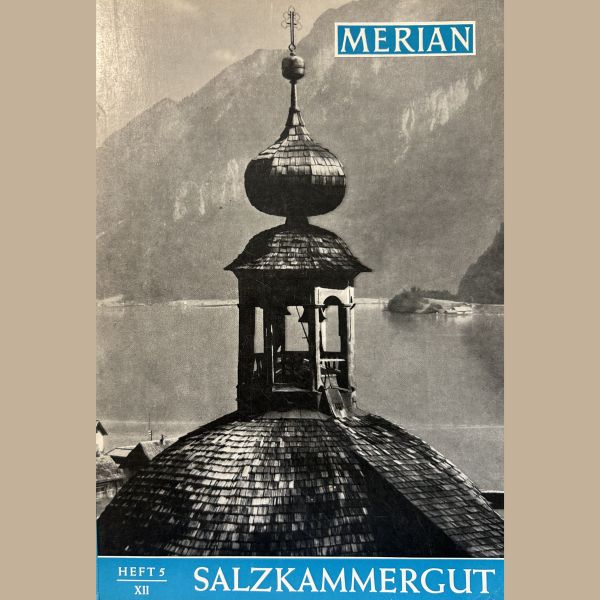
Bei uns auf dem Lande gibt es einen steilen Felsen, der, da und dort überhängend, am Fuß eines hohen Berges in den See stürzt; und zwischen dem Felsen und dem Berge schneidet ein kleines Tal oder, wenn man will, eine Art Paß den Felsen deutlich vom Berge ab und macht ihn zu einem umfriedeten Gebiet, das nicht allein als Vorberg von Bedeutung ist - vielmehr scheint er wirklich einen ganz eigenen, durch den Paß abgegrenzten Bezirk zu bilden. Nicht zwar, daß er sich schon durch seine Vegetation vom eigentlichen Berge unterschiede, etwa wie sich in der Nähe Wiens, charakteristischerweise, gewisse föhrenbestandene Felshügel finster von den freundlichen, laubholztragenden Höhen ihrer Umgebung abheben, als seien sie stehengebliebene Schollen einer untergegangenen, verschütteten Welt: hier wehen, hüben wie drüben, die gleichen Fichten im Bergwind, rauschen die gleichen Buchen und Ahorne, und allenthalben wuchern einander ganz ähnliche Arten von Enzianen und dieselben Teppiche aus Berggräsern und Blaubeergestrüpp; aber die eigentümlichsten Felsbildungen, die seltsamsten, gleichsam nierenartig quellenden Kalkgesteine, wie sie der Berg selbst kaum kennt weist das Vorgebirge auf, und von größeren und kleineren Höhlengängen ist es wie ein Schwamm, durchzogen, während der Berg nur riesenhafte, ungegliederte Hohlräume birgt, die so tief sind, daß man die Steine, die man in die Abgründe hinabwirft, keinerlei Boden finden hört. Ja, selbst die Umrisse riesenhafter Tierbilder scheinen, sei's nun von der Hand der Natur, sei's von irgendwelchen gewaltigen Geschlechtern der Vorzeit, in den Absturz der Felswand gezogen und spiegeln sich im See, so daß das ganze Gebiet von alters her im Rufe der Heiligkeit steht, wofür eine Einsiedelei im Hochtal, eine Kapelle nahebei, wo wunderwirkendes Wasser aus dem Boden quillt, sowie weitere Kapellen und eine Anzahl von Bildstöcken in der Bergschlucht noch immer sprechen.
Doch ist freilich all dieses Christentum nur ein Mäntelchen, das einem viel älteren, ja überhaupt schon Gott weiß wie weit zurückreichenden Heidentum zu guter Letzt noch mag umgehängt worden sein. Denn daß hier vorchristliche Kulthandlungen stattgefunden haben, scheint gewiß. Anders nämlich hätte ja auch das Christentum nicht ausdrücklich für nötig erachtet, sich in dieser Wildnis anzusiedeln und sie zu weihen. Wer aber waren die Menschen gewesen, die ursprünglich, wenngleich wohl nur zu bestimmten Zeiten des Jahres, hier hereinkamen, um anzubeten und Opfer zu bringen? Was für Opfer zu bringen und wen anzubeten? Welche Götter oder Dämonen waren's gewesen, zu denen diese Menschen gefleht hatten, und wie lange schon waren diese Zeiten dahin? Ja, hatten denn diese vorgeblichen Beter überhaupt gebetet und gefleht? Beschworen, bannten und verwünschten, kurz, zauberten sie nicht weit eher, wenngleich eines für sicher gelten kann: daß sie opferten. Was jedoch opferten sie? Früchte, Tiere oder gar sich selbst? Wir wissen es nicht und werden's wohl auch niemals wissen. Doch gleichviel, ein Hauch der Handlungen jener längst vergangenen Toten, ein Atem ihres Wesens weht noch immer um die heilige Stätte. In der Schlucht, die den Vorberg vom Berge scheidet, führt jetzt der Pfad, auf dem die christlichen Pilger an den Weihtümern vorüberziehen. Der heilige Weg der Heiden aber, so will uns scheinen, hat anderswo und auch gar nicht über den Paß hinweg und wieder ins Tal hinab, sondern auf die Höhe des Vorberges geführt, um dort zu enden, als seien die Opfer von solcher Art gewesen, daß es danach weder ein Weiter noch eine Wiederkehr gegeben habe.
Zwischen den Paß nämlich und den Absturz des Felsens, in den eigentlichen Rücken des Vorbergs, ist ein weiteres Tälchen gegraben, und in dieses fühlen wir uns, sobald wir, von Westen heraufsteigend, zur halben Höhe gelangt sind, auf eigentümliche Weise hineingelockt und hineingezogen. Seewärts zweigt hier, versteckt und verwachsen zwar, aber dennoch unverfehlbar, der Weg der Vergangenheit von dem der Gegenwart ab. Die Bildung des Bodens, der einer Rinne gleicht, die Formen der Felsen, die den Wanderer wie Ufer begleiten, führen ihn auf eine viel selbstverständlichere Weise in die Wildnis, als es der Pilgerweg vermag, und nach wenigen Schritten schon merkt er klopfenden Herzens, daß er ganz in den Bann des Heidentums geraten ist. Die Natur ringsum zwar unterscheidet sich, scheint es, in nichts von derjenigen, durch die der Pilgerweg führt. Zugleich aber zieht uns dennoch alles und jedes, das sanfte Sausen der Fichten, das Fallen der Tropfen von den Felsenwänden, das Spielen der Sonnenlichter im Waldesgrund, auf viel vertrautere und dennoch unheimlichere Art, die uns erschauern läßt wie die Schrecken in den Märchen, mit sich fort. Nirgendwo findet sich, in all dieser Zeitlosigkeit der Natur, eine deutliche Spur der Vergangenheit, ein wirklicher Überrest der Vorwelt doch scheint die ganze Luft erfüllt vom Wehen seltsamer Schatten, vom Flüstern durcheinanderbewegter, gespenstischer Gestalten im unsichtbaren Sommerwind. Wohin wandern sie wohl, wohin zieht es sie wie uns? Aus dem Flachland sind sie, wie einst, gekommen, nun schreiten sie neben uns, nun schreiten wir neben ihnen her durch Waldmulden und über Steine, die wie Treppenstufen gesetzt sind, nun geht es zwischen Felsen weiter, wo ein Pfad schon seit jeher geführt haben muß. Wir schreiten das Tälchen, den Opferpfad, den heiligen Weg hinan, bis er sich im Dickicht verliert, bis die Senke verflacht, bis wir, auf dem Gipfel des Vorbergs, nichts finden als etwa die verlassene Feuerstätte eines Sonnwendfeuers und wiederum nur flüsterndes Gras und das Wehen des Windes...
Unheilig sind längst schon die Wege geworden, welche die Welt nun geht, doch zahllose heilige Wege ist die Menschheit vorzeiten gegangen. Verwachsen und ganz vergessen sind die meisten von ihnen, im Walde versunken und im Staube der Felder verweht. Ihrer einigen aber war dennoch bestimmt zu dauern, sie währen noch jetzt, mit schallenden Platten gepflastert und ganz zu Stein erstarrt wie der heilige Weg auf Delos, den die Marmorlöwen begleiten, wie der Pfad der Beter in der "von Brandung erdonnernden" Au von Kyrene, wie die Sphinxalleen, die in Ägypten zu den Tempeln führen, oder wie die geweihten Straßen über das Forum der Römer, auf die Hochstadt von Athen und durch Delphis und Dodonas heilige Bezirke.
Ihnen allen aber, selbst den unvergänglichsten und berühmtesten, scheint ein Heimweh anzuhaften nach den vergessenen und versunkenen heiligen Wegen im Wald, und bei ihrer jedem, unter der funkelnden Sonne des Südens und in unsäglich herrlichem Licht, gedenken wir der regenumrauschten Wege in unserer Heimat, die auch die Heimat dieser Wege war.
Denn von wo wir nach dem Süden reisen, um zu bewundern und zu bestaunen, ist ehmals auch die Art gekommen, dergleichen Wege zwischen Schatzhäusern und Opferstätten, zwischen Tempeln und Heiligtümern hinzuführen, damit man auf ihnen einherziehe, bewundere und bete. Längst sind Ägypter und Kreter, Ionier und Dorer dahin, und wenngleich sie, verglichen mit denen, die in unvordenklichen Zeiten die Wege im Wald hier gegangen, erst wie seit gestern dahin sind, sind doch auch sie schon wie seit immer dahingegangen. Auch unsere eigene Welt hat die Ehrfurcht vor dem Hohen und Heiligen verloren und geht ihrer Wege, die Wege der Welt, als sei es seit jeher. Wird sie wieder zurückfinden auf die Wege von einst? Das haben wir uns schon daheim gefragt auf jenem Weg im Walde, und das fragen wir uns wieder beim Anblick all jener heiligen Wege.