Der Helweg
Zu einem zentralen Motiv im erzählerischen Werk Alexander Lernet-Holenia
Von Armin Ayren
In: Alexander Lernet-Holenia: Der Mann im Hut, Paul Zsolnay, Wien, 1975
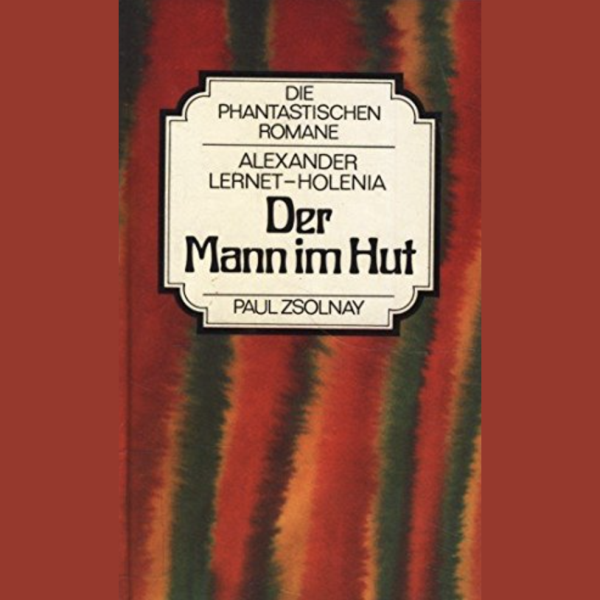
Nichtsagbares dennoch sagbar zu machen, über die Grenzen von Erfahrung, Vernunft und Wissenschaft hinaus, war von jeher eine der vornehmsten Möglichkeiten der Dichtung und hat ihr auch zu allen Zeiten einen Schimmer von Magie verliehen oder vielmehr bewirkt, daß das Wissen um ihren magischen Ursprung nie ganz verlorenging. Wie ein lyrisches Gedicht nicht gleichwertig in Prosa wiedergegeben werden kann, weil es sich nicht in der prosaischen Bedeutung der Wörter erschöpft, so kann auch dichterische Prosa desto weniger auf ihren informativen Inhalt reduziert werden, je mehr sie von Dingen spricht, die eigentlich nicht mitteilbar sind, und je mehr sie dies auf eine Weise tut, die über bloße Mitteilung hinausgeht. Wählt ein Dichter solche Gegenstände und macht sie zu bevorzugten Themen seines Werks, so offenbart er rasch, ob er wirklich Dichter ist, denn über das Nichtsagbare darf nur zu sprechen wagen, wer dazu befugt ist: der außerordentliche Gegenstand erfordert außer ordentliche Fähigkeiten und wird so zum Prüfstein der poetischen Talents.
Eines der zentralen Motive im dichterischen Werk Alexander Lernet-Holenias ist der Tod, genauer gesagt das Sterben, noch genauer: die Spanne Zeit, die zwischen Beginn und Ende dieses Vorgangs liegt.
Überblickt man die zahlreichen Gestaltungen dieses Themas im Werk des Dichters, so fällt auf, wie unwichtig es ist, ob es sich dabei de facto um den langsamen Todeskampf Dahinsiechender, um allmähliches Hinüberdämmern und Verlöschen, oder um den rasch eintretenden, plötzlichen Tod handelt. Denn ähnlich wie im Traum die Zeitverhältnisse nicht denen der Realität entsprechen, erleben Lernets Sterbende ihren Tod stets als einen Vorgang, der sich in einem ausgedehnten Zeitraum abspielt. Entweder treten sie die Reise ins Jenseits an, eine Fahrt oder einen Ritt, oder sie liegen in einer Wiese und werden sehr langsam, fast unmerklich, eins mit dieser.
Der ersten dieser beiden Vorstellungen liegen mythische Leitbilder zugrunde, auf die sich der Dichter auch mehrfach beruft. So steht über dem Gedicht "Todesfahrt" programmatisch der Satz: "Wenn ein Mann gestorben ist, muß er neun Tage und neun Nächte lang nach Norden in das immer tiefer sinkende Tal des Todes reiten.“ Zum Schluß gelangt er an eine goldene Brücke. Sie zu überschreiten bedeutet das endgültige Erlöschen im Diesseits. Nicht nur die germanische Mythologie kennt diesen der Überfahrt mit Charons Nachen über den Styx vergleichbaren Ritt über die Gjöll-Brücke; auch bei den Arabern, wo die Brücke Es Sireth heißt, und anderswo begegnet er uns. Das Sterben als Abreise vollends ist in den Todesvorstellungen vieler Völker zu Hause; bildnerisch gestaltet findet man sie am eindrücklichsten auf den sehr zahlreichen Urnen im Etruskermuseum zu Volterra.
Da Tote nicht mehr berichten können, hat der Dichter verschiedene Lösungen gesucht und auch gefunden, das Erlebnis des Helwegs gleichwohl erzählbar zu machen. Eine der überzeugendsten zeigt die nicht ohne Grund berühmt gewordene Novelle Der Baron Bagge: der Held kehrt um. Neun Tage lang reitet er, nachdem er mit seiner Schwadron eine feindliche Brücke genommen hat und dabei, wie er glaubt, nur von spritzenden Kieseln getroffen worden ist, immer tief er in Feindesland, ohne je dem Feind zu begegnen. Die Gegend wird zusehends düsterer und beklemmender, die Sonne scheint nur noch grau wie durch Schleier und kommt dann gar nicht mehr, und in einer Stadt, wo man schließlich Quartier nimmt, erlebt Baron Bagge eine seltsame und ergreifende Liebesgeschichte. Die Empfindung, das alles könne fast nur ein Traum sein, verstärkt sich immer mehr, und als er schließlich erwacht, sind seit dem Angriff auf die Brücke nur wenige Sekunden vergangen - die Kiesel waren Kugeln, alle Kameraden der Schwadron sind gefallen. In diesen Augenblicken aber hat sich für den Helden das eigentliche Ereignis abgespielt, das Außerordentliche und Einmalige, das nach Goethe den Kern der Novelle bildet, Heyses "Falke".
Im sechs Jahre später, nämlich 1942, erschienenen Roman Beide Sizilien läßt Lernet den Leutnant Silverstolpe an einer rätselhaften Krankheit dahinsiechen; der erste Schritt auf dem Todesweg, zeitlupenartig gedehnt, erscheint als Erzählung eines merkwürdigen Erlebnisses, das Silverstolpe in einem Brief seinem Freund, dem Marschall von Sera, mitteilt.
Silverstolpe ist einer der Offiziere des Regiments Beide Sizilien, die, lange Zeit nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und der Auflösung des Regiments, nacheinander auf unerklärliche Weise zu Tode kommen, nach dem Willen des Autors, für den Kriege große, unerhörte Ereignisabläufe sind, die nicht von ungefähr entstehen und auch nicht mit dem letzten Schuß beendet sind, sondern weiterwirken, nicht nur im Sinne der vielfältigen realen Folgen, sondern in einer umfassenderen und existentielleren Weise: "Ein wirklicher Krieg geht nie zu Ende." Dem Autor gelingt es, Silverstolpes Sterben zu einem Vorgang zu machen, dessen Einbettung in mythische Vorstellungen der Leser so fraglos akzeptiert, als gehöre sie selbstverständlich, ja notwendig zu jedermanns Erlebnisbereich. Die Passage verbindet das Motiv des Helwegs mit dem der zeitweiligen Entrückung, das der Autor auch anderswo verwendet hat, in ähnlichem Zusammenhang vor allem in den Romanen Der Mann im Hut und Mars im Widder. Zugleich taucht hier ein drittes Motiv auf, das Lernet ebenfalls häufig dann einsetzt, wenn er seine Gestalten in Situationen des Außerordentlichen, der plötzlichen Gefahr und Todesbedrohung führt: das des Eintritts ins Erdinnere, in unterirdische Gänge, Berghöhlen und Katakomben. Man darf vermuten, daß der Kavallerieoffizier Lernet-Holenia im Ersten Weltkrieg einmal verschüttet war oder eine ähnliche Erfahrung früh gemacht hat. Spuren davon finden sich in seiner Prosa häufig; breiter ausgeführt wird das Thema' fünfmal, zum tragenden Gestaltmotiv erhoben jedoch erst beim letzten Mal, im Roman Der Graf Luna. Es lohnt sich, die vorhergehenden Ansätze näher zu betrachten:
Zum ersten Mal begegnen wir dem Motiv in Lernet erfolgreichstem Roman Die Standarte, wo die Hauptpersonen in Lebensgefahr durch die unterirdischen Gänge des "Konak", der Belgrader Burg, fliehen. Die Schilderung dieser Flucht ist von großer Intensität; die Verbrecherjagd durch Wiens Abwässerkanäle in Graham Greenes Roman Der dritte Mann könnte davon inspiriert sein.
In humoristischer Abwandlung kehrt das Motiv in der Erzählung Das Einhorn wieder, wo der Dichter auf der Suche nach dem Herkunftsort seiner Väter in der Nähe eines französischen Dorfes namens Lerné von einem Einhorn, das aus einem Zirkus ausgebrochen ist, durch die unterirdischen Gewölbe und Gänge des Château du Coudray verfolgt wird, bis er schließlich, er, der Autor der satirischen Romane Das Finanzamt und Das Goldkabinett, einen rettenden Ausgang findet, der sich aber als das Büro des Finanzamts von Lerné erweist. Ein Traum natürlich das Ganze, und zugleich ein kleines humoristisches Meisterwerk, das den Autor von einer Seite zeigt, die man zwar aus den Abenteuern eines jungen Herrn in Polen und aus verschiedenen Geschichten des Sammelbandes Das Bad an der Belgischen Küste auch aus seiner Prosa kannte, sonst aber eher in seinen frühen Komödien zu finden gewohnt war.
Drei Jahre nach der Standarte kehrt das Höhlenmotiv im Roman Der Mann im Hut wieder. Neu ist hier, daß der Eingang ins Erdinnere durch eine Kapelle erfolgt. Durch eine Kapelle, eine ehemalige Eremitenklause, an den Berghängen eines österreichischen Sees gelegen, gelangen ein Jahr später auch die Hauptfiguren des Romans Strahlenheim in geheimnisvolle Höhlen im Berginneren und dadurch in Lebensgefahr.
Diese beiden Romane verraten ihre zeitliche Nähe auch durch unheimliche, ins Irreale führende Wettererscheinungen, ein Motiv, das Lernet später nicht mehr verwendet hat. Hier aber spielt es eine entscheidende Rolle, und man denkt unwillkürlich an den Anfang von Günter Eichs Funkerzählung Die Andere und ich: "Dr. Sedgewood, unser Hausarzt in Washington, findet, alle Ereignisse im menschlichen Leben seien auf diese oder jene Weise vom Wetter bestimmt."
Erst in Lernet-Holenias letztem Roman von herausragender Bedeutung finden sich alle vier Motive wieder vereint und diesmal zu einem überzeugenden Ganzen verschmolzen: Wetter, Helweg, Höhlen und der Eingang dazu durch eine Kirche oder Kapelle. Dieser Roman, der 1955 erschienene Graf Luna, behandelt das Thema der Schuld. Die Hauptfigur ist Alexander Jessiersky, ein Abkömmling altrussischer Adeliger. Von der Herkunft und vom ungeliebten Vater ist ausführlich die Rede. Als der Vater stirbt, ist dem Sohn, als "werde der Leichenwagen den Vater nicht auf einen der Friedhöfe der Stadt, sondern zurück nach Polen oder gar nach Rußland fahren".
Als er das Bewußtsein bereits verloren hatte, erschien ein Priester, um ihn zu versehen; und dabei salbte er ihm auch die Fußsohlen für den Weg in die Ewigkeit. Aus diesem Anlasse schlug jemand die Bettdecke zu weit zurück, und es stellte sich heraus, daß des Obersten sonst so wohlgeformte Beine elend abgemagert und schon gänzlich ungeeignet waren, ihn in die Ewigkeit zu tragen. Aber er würde ja auch nicht zu Fuß gehen wie irgendein Bauer oder Landstreicher, er würde fahren. Nicht einmal auf den Leichenwagen war er wirklich angewiesen. Denn die toten Jessierskys [ ... ] würden ihm ganz gewiß einen Wagen oder Schlitten aus dem Jenseits schicken; und die galizischen Halbblüter, mit denen der Schlitten bespannt war, würden den Toten, umklingelt und umflogen vom Schmuck ihrer Kopfgestelle, reißend schnell in die Ewigkeit ziehen [ ... ] Monate und Jahre, ungewöhnlich lange Zeit jedenfalls für einen Knaben, dachte der Sohn über diesen Tod des Vaters nach [ ... ] Er war niemals in Polen gewesen, malte sich nun aber ein phantastisches Polen aus, in welchem sich die toten Jessierskys wie in einer Art von Jenseits aufhielten und aus dem nun auch schon der Totenschlitten gekommen war. Unter einem grauen Himmel, aus dem es zwar nicht schneite, doch ständig mit Schnee drohte, fanden fortwährende Zusammenkünfte der Toten und wechselweise Einladungen auf die Güter statt, wo die Abgeschiedenen im Tode lebten; und oft dauerten die gespenstischen Feste die ganze Nacht und bis in den nächsten Tag hinein, der grau wie der vorhergegangene über das unendliche, mit altem Schnee bedeckte Land heraufstieg. Diese Unendlichkeit des Landes schien dem Träumer, indem er den Raum in die Zeit übersetzte, die Ewigkeit. Er selbst aber, der Träumer, war zu diesem ewigen Leben nicht eingeladen und würde wohl auch, so dachte er, nie dazu eingeladen werden.
Der Knabe irrt sich, so wie der Erwachsene sich sein Leben lang irren wird. Ohne es zu wollen, aber auch ohne etwas dagegen zu tun, wird er die Ursache dafür, daß ein unschuldiger Privatgelehrter, ein gewisser Graf Luna, ins KZ gebracht wird und darin umkommt. Von Lunas Tod erfährt Jessiersky nichts, glaubt den Grafen nach dem Kriege vielmehr lebend, sucht ihn, um nach Kräften das begangene Unrecht wiedergutzumachen, kann ihn aber nicht finden und wähnt sich bald, unglücklicher Umstände wegen, vom rachsüchtigen Grafen verfolgt. Er verfolgt ihn nun seinerseits - eine gespenstische Jagd nach Lunas Schatten. Im Verlauf dieser Jagd begeht Jessiersky mehrere Morde, verstrickt sich immer tiefer in tatsächliche Schuld und glaubt schließlich der Justiz nur noch durch eine Flucht entgehen zu können, die ihn in den Augen seiner Verfolger in den Katakomben Roms umkommen lassen, ihn jedoch in Wirklichkeit nach Amerika und in ein neues Leben führen soll. Angeblich, um nach zwei darin verschollenen französischen Priestern zu suchen, verschafft sich Jessiersky Zugang zu den bei der Via Appia antica liegenden Praetextatus-Katakomben, indem er den Kustos der Kirche von San Urbano besticht, so daß dieser ihm, ohne es zu dürfen, den Eingang, der sich unter dem "tischähnlichen Altar der Unterkirche" befindet, freigibt. Jessiersky verschwindet darin, um, wie er glaubt, mit Hilfe einer guten Karte an verborgenem Ort wieder ans Tageslicht und unerkannt unter anderem Namen nach Amerika zu entkommen - in Wirklichkeit aber für immer. Denn er verirrt sich; die Karte war zwar schön gestochen und mit einer herrlichen Widmung an einen Kardinal versehen, aber ungenau. Die Katakomben werden Jessierskys Grab, wie sie schon das Grab so vieler gewesen, und über diese Heimkehr in die Erde gibt es im Roman einige bemerkenswerte Aussagen. So heißt es dort unter anderem:
Im allgemeinen darf man annehmen, daß sich die ersten Bekenner unseres Glaubens aus Furcht vor ihren Verfolgern unter den Erdboden zurückzogen. Aber gewiß haben sie's nicht nur aus diesem Grunde getan. Vielmehr scheinen sie den Schoß der Erde [ ... ] auch aus anderen, nämlich aus Ursachen der Gläubigkeit selbst, aufgesucht zu haben. Alle Mysterienkulte jener Zeit [ ... ] zeigten ja, auch wenn sie nicht verfolgt wurden, eine Neigung, unter die Erde zu fliehen; und zwar war's die Hoffnung, daß das Dunkel ein Mittel zur Erhellung der Dunkelheiten des Daseins, das Geheimnis an sich schon ein Schlüssel zur Erschließung aller übrigen Geheimnisse sein möchte [ ... ].
Anders als im Baron Bagge und in ähnlichen themenverwandten Werken kehrt also der Held nicht zurück. Wie aber kann der Dichter, ohne sich in die Pose des allwissenden Erzählers zu begeben und ohne den wenig überzeugenden Kunstgriff letzter Aufzeichnungen hervorzuholen, dem Leser die letzten Stunden - nein: die neun Tage von Jessierskys Helweg schildern?
Die Lösung, die er findet, verdient Bewunderung. Schon rein formal ist sie überaus glücklich: das letzte Kapitel schließt thematisch ans erste an; der Roman erhält dadurch eine bemerkenswerte Geschlossenheit. Besonders originell aber ist die Erzählhaltung des sich leise steigernden Humors, überraschend bei solcher Thematik, jedoch durchaus überzeugend und, vom Romanganzen her gesehen, sogar von zwingender Notwendigkeit: ein Alexander Jessiersky, der zuletzt seine Schuld begriffen und die Tatsache, daß er sich in seiner eigenen Falle gefangen, als gerechte Sühne akzeptiert hätte - das hätte einen Bruch in seinem Charakter bedeutet, dem ihn der Autor bis zuletzt treu bleiben läßt, weil nur so völlig deutlich wird, was er zeigen wollte: daß nämlich ein relativ schwacher und vor allem realitätsferner Mensch durch außerordentliche Umstände zu Handlungen geführt werden kann, deren er unter normalen Umständen unfähig wäre, ohne sich dabei jemals bewußt zu werden, wie weit es mit ihm gekommen ist.
Der Autor läßt seinen Helden im vorletzten Kapitel des Romans sterben, nicht mehr aus den Katakomben auftauchen, und beginnt darauf das letzte Kapitel mit den Worten: "In Wirklichkeit aber dürfte es mit Alexander Jessiersky zu Ende gegangen sein wie folgt" - und nun begleitet der Leser Jessiersky auf dem neuntägigen Weg. Dieser will zunächst nicht daran glauben, daß aus der Finte Ernst werden soll. Als er, nach langem vergeblichen Herumirren, allmählich an Hunger und Erschöpfung stirbt, wird dies in der Gestaltung des Dichters nicht zur Tragödie, sondern, dem Charakter des Helden entsprechend, der immer halb Kind geblieben ist und nun in die Kindheit zurückkehrt, zur Komödie. Jessiersky begegnet den beiden französischen Priestern, die gekommen sind, um ihm mit Lebensmitteln zu helfen und ihn zum Ausgang zu führen, und findet diesen auch:
Das kann doch, um Gottes willen, nicht mehr die Ebene von Rom sein! dachte Jessiersky. Wie weit die Katakomben unter der Erde reichen! Wo ich nur bin? - Die Priester waren verschwunden, und Jessiersky ging auf den Schlitten zu. über den Fond des Fahrzeugs war eine Decke aus Fuchsfellen gebreitet, und die Pferde, mit denen es bespannt war, offenbar hohe Halbblüter, bewegten die Köpfe in geschmückten, klingelnden Geschirren.
Es geht, wie man errat, im Flug nach Osten. Jessiersky fährt, wie Lernet nach Lerné, zurück in die Kindheit, heim zu den Vätern, die dort im Schattenreich unter dem ewigen Schneehimmel Polens ihre gespenstischen Feste feiern und den Sohn lachend und mit Schnäpsen und Tanz willkommen heißen, und erst als der Neuankömmling, müde vom turbulenten Empfang und der weiten Reise, ins Bett sinkt, "fiel er gleich in Schlaf und verlor, endlich, das Bewußtsein". Die Helfahrt als traumhafte Rettung vor der physischen Not des Verhungerns: mythische Schwere gerät dem Dichter hier in der Umkehrung, die sich in der Phantasie des Sterbenden vollzieht, zu erlösender Leichtigkeit.