Der Baron Bagge - Rezension Dr. Franziska Mayer (2014 Deutsch)
Nachwort
In: Der Baron Bagge, Edition Sonblom 2014, S. 66-69.
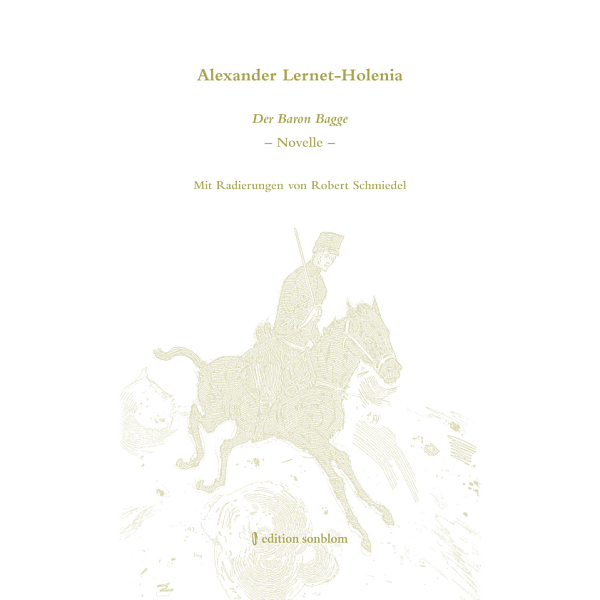
Alexander Lernet-Holenias Novelle Der Baron Bagge von 1936 ist einer jener Texte über den Ersten Weltkrieg, die den Fokus weniger auf den Krieg selbst als auf das Leben der Kriegsheimkehrer nach 1918 legen. Wie Joseph Roths Flucht ohne Ende (1927) und Leo Perutz' Wohin rollst du, Apfelchen ... (1928) schildert er die Schwierigkeiten der Soldaten, sich in eine Nachkriegsgesellschaft zu integrieren, die sich im Falle Österreichs fundamental von jener Gesellschaft vor dem Krieg unterscheidet.
Der Österreicher Lernet-Holenia (1897-1976) oder Alexander Lernet, wie er damals noch hieß, hatte sich 1915 selbst als Einjährig-Freiwilliger bei den Dragonern gemeldet und von 1916 bis 1918 im Osten am Ersten Weltkrieg teilgenommen. Ähnlich wie bei seinem Kollegen Heimito von Doderer war das Kriegserlebnis die Initialzündung für sein Schreiben, doch begann der in Kärnten und Wien aufgewachsene Lernet zunächst mit Lyrik in der Rilke- und Hofmannsthal-Nachfolge. Von seinen Vorbildern ermuntert und gefördert, erschien 1921 sein erster Gedichtband Pastorale in einem bibliophilen Kleinverlag in Wien. Erfolge feierte der junge Dichter, der sich nach der Adoption durch
die Familie seiner Mutter inzwischen Lernet-Holenia nannte, in den Zwanzigerjahren vor allem als Bühnenautor. 1926 erhielt er für zwei Komödien, Ollapotrida und Österreichische Komödie, den renommierten Kleist-Preis. Seit diesem Jahr wohnte er in einer Villa seiner Mutter am Wolfgangsee, unter prominenten Künstlern eine beliebte Sommerfrische. Hier verkehrte er mit Leo Perutz und Stefan Zweig sowie mit den aus NS-Deutschland emigrierten Ödön von Horváth und Carl Zuckmayer. 1930 erschien der erste Roman, und zwar in Berlin bei S. Fischer, der bis 1945 sein wichtigster Verlag blieb. In schneller Folge publizierte Lernet-Holenia bis 1938 vierzehn Erzählbände und Romane, von denen drei verfilmt wurden: Die Abenteuer eines jungen Herrn in Polen, Ich war Jack Mortimer und Die Standarte.
Schon der letztgenannte Roman hatte 1934 die Desillusionierung eines österreichischen Fähnrichs durch den Zusammenbruch der Monarchie und den Zerfall des Habsburgerreiches ins Zentrum einer gerahmten Rückblickserzählung gestellt, schon hier zerstört die Bindung an die alten militärischen Werte, repräsentiert durch die titelgebende Standarte, das Leben der jungen Männer. Zwei Jahre später griff die Novelle Der Baron Bagge erneut das Kriegsheimkehrerproblem auf, wenn auch in
beiden Fällen der weitaus größte Teil der Handlung im Krieg selbst spielt. Und noch mitten im Zweiten Weltkrieg, 1942, widmete sich der Autor dem Thema erneut in Beide Sizilien, wo eine Mordserie unter Offizieren des im Titel genannten Regiments das Sterben in die Zwischenkriegszeit hinein verlängert.
Im Unterschied zu berühmten Weltkriegsromanen wie Erich Maria Remarques Im Westen nichts Neues (1929) erscheint der Krieg bei Lernet-Holenia nicht als entmenschlichte Materialschlacht. Vielmehr lässt das Agieren von Kavalleriepatrouillen in zum Teil noch glänzend-bunten Vorkriegsuniformen durchaus Spielraum für individuelles Handeln und Entscheiden. Gemeinsam ist den Kriegstexten des Autors der Verfall militärischer, politischer und moralischer Werte, der den Zerfall des Vielvölkerstaates vorwegnimmt.
Doch ist es im Baron Bagge nicht so sehr die Distanz zwischen den „slawischen Bauerngesichter[n]" der Mannschaft und dem kosmopolitischen Habitus der Offiziere - sogar ein Amerikaner aus Kentucky hat sich aus nicht näher erläuterten Gründen der österreichischen Armee angeschlossen, freilich noch vor Kriegseintritt seines Landes, wie der Erzähler klarstellt -, die zur Katastrophe führt, sondern das eigenmächtig- selbstmörderische Agieren des Befehlshabers Semler, der seine Schwadron in ein mörderisches Gefecht gegen russische Truppen schickt. Immer wieder betont Bagge, dass sich der Rittmeister nicht an das Reglement für Aufklärungspatrouillen hält, sondern fast besessen und gegen den Rat seiner Offiziere sich selbst und die ihm Anvertrauten in die Vernichtung treibt. Es ist hier also die (militärische) Führung, die jene finale Katastrophe auslöst, die stellvertretend für das Ende des ganzen Unternehmens Weltkrieg steht. Dem Ich-Erzähler, der, wie sich später herausstellt, als einer der wenigen das Gefecht überlebt, ist durch dieses Erlebnis eine Rückkehr in das zivile Leben verschlossen.
Der Selbstmord zweier Frauen und ein verhindertes Duell um eine dritte motivieren die Erzählung des Protagonisten, dessen Weltkriegserlebnisse sein abweichend-problematisches Verhältnis zu Frauen erklären sollen: „Denn ich war eigentlich schon verheiratet, und das kam so". Die folgende Binnenerzählung liefert schließlich die Erklärung für diese Aussage: In einer fantastischen Traumreise zwischen Leben und Tod war er jener Frau begegnet, die seine verstorbene Mutter ihm als Ehefrau zugedacht hatte, und hatte sie geheiratet. Als er aus dem Traum erwacht und erkennen muss, dass
Charlotte wie alle anderen Figuren, denen er nach dem Gefecht begegnet war, tot ist, ist er für alle erotischen Alternativen verloren; er wird geradezu zum uneinnehmbaren Objekt weiblicher Begierde, an dem mehrere Frauen tödlich scheitern.
Zentrales Motiv der Novelle ist die Brücke als Bestandteil der Topographie der realen oder geträumten Welt wie als mythischer Übergangsraum zwischen Leben und Tod. Gemeinsam ist diesen Brücken, dass sie vom Protagonisten nicht überschritten werden können. Stets bleibt er auf der Grenze, einem Zwischenreich zwischen Tod und Leben, aber auch zwischen der von der Mutter dominierten Jugend und dem Erwachsenenalter. Nur die erste Brücke über den Fluss Ondawa wird real erreicht. Hier kommt es zu jenem Gefecht, das Bagge beinahe als Einziger, verletzt und ohne Bewusstsein, überlebt. Die zweite - geträumte - Brücke über den San deutet der Erzähler zur letzten Etappe des nordisch-mythischen Helwegs um, den der gefallene Held in neun Tagen zurücklegt, bevor er endgültig den Todesraum erreicht. Im Traum kehrt Bagge hier als Einziger um. Doch es ist keine Rückkehr ins Leben. Vielmehr bleibt er in jenem Zwischenreich, in dem die Grenze zwischen Tod und Leben unbestimmbar ist.
In dem geträumten Raum, den er im Traum in neun Tagen durchquert, sind die Merkmale von Tod und Leben vertauscht: Die Natur wirkt tot und erloschen, die öde ungarische Kleinstadt wird zum übervölkerten vitalen Ausnahmeraum, in dem ständig gefeiert und getafelt wird. Dasselbe gilt auch für die Figuren: Die russischen Soldaten, von denen es in jener Gegend zu diesem Zeitpunkt wimmeln müsste, sind mysteriöserweise verschwunden; lebendiger und attraktiver als alle realen Frauen erscheint die tote Traumfrau Charlotte. Selbst nach dem Erwachen verwischt die Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit ebenso wie jene zwischen Leben und Tod: „Zwischen den Träumen aber führten Brücken hin und wider, und wer könnte wirklich sagen, was Tod und was Leben sei oder wo der Raum und die Zeit zwischen beiden beginnen und wo sie enden!"
Zwar können die gescheiterte Reintegration in die Nachkriegsgesellschaft und das Festhalten an der Traumwelt als Kollateralschaden des verlorenen Krieges gelten, doch vermag Bagge dieses Scheitern durch seine eigene Darstellung zu seinen Gunsten umzudeuten. Stellvertretend hatte Charlotte das autoerotische Liebeskonzept des Protagonisten formuliert, der Liebe ausschließlich als Projektion eigener Wünsche denken kann: „Es gibt wohl keine wirklichen Beziehungen zwischen den Menschen. Es kann keine geben. Man ist einander immer nur ein Anlaß, sonst nichts." Und wie die erträumte Charlotte jeder realen Frau überlegen ist, so ist auch die geträumte Lebensgeschichte gegenüber der realen Biographie Bagges eindeutig im Vorteil. Ohne das erträumte Erlebnis auf der Brücke zwischen Leben und Tod bliebe ihm lediglich seine schwere Verwundung bei einem unsinnigen Gefecht in einem verlorenen Krieg eines mittlerweile zerfallenen Reiches. So aber fantasiert er sich selbst zum privilegierten Außenseiter, der als Einziger aus diesem Raum wieder zurückkehrt.
Dadurch gewinnt er dem sinnlosen Krieg letztlich doch noch einen individuellen Sinn ab, der freilich mit dem Krieg und seinem Ausgang wenig zu tun hat.
Die Unfähigkeit der Protagonisten in Lernet-Holenias Kriegsromanen und auch im Baron Bagge, mit der Realität nach dem Krieg und dem Ende der Monarchie zurechtzukommen, wird durch ihre fantastischen Erlebnisse, vor allem aber durch die nachträglichen Zuschreibungen eines höheren Sinns durch die Ich-Erzähler selbst kompensiert. Das wahre Leben spielt sich eben im Traum - oder besser noch: in der Literatur - ab.
München, im Mai 2014