»Es gibt Taten, die so ungeheuer sind, daß keine Sühne hilft« Über das Zeitgemäße an Lernets Germanien
Dr. Daniela Strigl
Rezension zu Germanien (1946), eine Elegie von Alexander Lernet-Holenia
In: "Schuld-Komplexe" Das Werk Alexander Lernet-Holenias im Nachkriegskontext, Hrg. Hélène Barrièr, Thomas Eicher und Manfred Müller, ATHENA-Verlag, Oberhausen, 2004
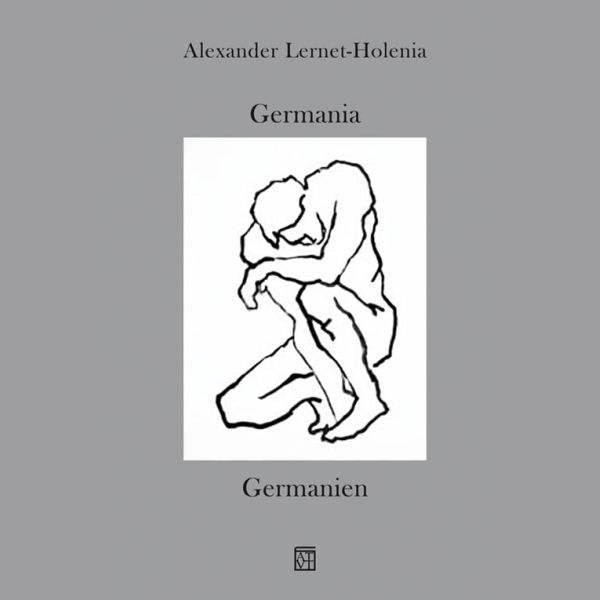
Im Österreichischen Tagebuch veröffentlicht Hugo Huppert, der kommunistische Autor und Funktionär, im Juli 1947 einen »Offenen Brief an Alexander Lernet-Holenia«. Darin heißt es:
Neulich habe ich, im Stadtpark am Weiher sitzend, fast in einem Zug Ihren klei-
nen Roman ›Ljubas Zobel‹ durchgelesen und war redlich entsetzt. Und abends las
ich dann zu Haus im dritten Heft des ›Silberboots‹ Ihr Poem ›Germanien‹ - und
war ehrlich begeistert. (1)
Ehe das Gedicht, das den Marxisten begeisterte, in Ernst Schönwieses unpolitisch-konservativer, ästhetisch der klassischen Moderne verpflichteter Zeitschrift das silberboot erschien, war es 1946 gleich zweimal als eigenständige Publikation herausgekommen, und zwar jeweils an durchaus prominenter Stelle: bei Bermann-Fischer in Stockholm und bei Suhrkamp in Berlin. Das mediale Echo war, vor allem im Jahr darauf, in Anbetracht der Nachkriegsnot beachtlich. Warum?
Eine zentrale Strophe des 344 Verse langen Gedichts, beginnend mit
Vers 132, lautet:
Schiebt nicht die Schuld auf andre, - diese Schuld
und alles andre Schuldsein! [...]
wenn, was von den Größten einer tut,
auch ihr getan habt, habt ihr auch getan,
was der Geringsten einer tut im Volk.
Sagt nicht: Nicht ich war's, - der! Nicht ich war's, — die!
Wenn man die Schuld euch allen auflädt, tragt
sie denn auch allesamt! Ihr wälzt ja doch
nicht mehr vom Einzelnen, was alle trifft.
Es geht der Welt nicht mehr um Einzelne.
Wenn man euch zählt, so zählt nicht hintendrein,
wenn man euch wägt, so wägt nicht nach. Wenn man
euch richtet, richtet nicht . . . Denn was ist Schuld!
Weil keiner sich von allen gegen die
gemeinsame, die ungeheuere,
erhob, war jeder schuldig. Beugt euch denn
und tragt es alle! Trägt nicht jeder, weil
er sie nicht tragen will, die ganze Last?
Nur wer ihr nicht entgehn will, trägt sie leicht? (2)
Alexander Lernet-Holenia verbietet in Germanien dem deutschen Volk jede Selbstrechtfertigung, jedes Sichherausreden, jedes Aufrechnen der eigenen Schuld mit den Verbrechen seiner einstigen Feinde. Lernet redet klipp und klar der These von der deutschen Kollektivschuld das Wort. Sein Argument ist logisch: Wenn Nationalstolz sich aus den Ruhmestaten anderer speist, dann muß es auch eine Nationalschande geben, die man ob der Schandtaten anderer empfindet. Nicht erst in seinem Roman Der Graf Luna, wie Roman Rocek meint, bezieht Lernet »auch die schuldlos schuldig Gewordenen mit in das Gericht ein«.(3) Das war 1947, als die Entnazifizierung auf vollen Touren lief, höchst provokant, ging es doch darum, die »Minderbelasteten« möglichst rasch wieder in die Gemeinschaft, die nun nicht mehr »Volksgemeinschaft« hieß, zu integrieren und zu rehabilitieren. Und wer ihnen das erlaubte, die Unbelasteten, die sollten nun auch schuld sein? Schließlich konnte man nur den entnazifizieren, der vorher Nazi gewesen war.
Gegen die Idee der Kollektivschuld wandten sich diejenigen, die es nicht wagten, jede Schuld laut von sich zu weisen. Zu einer gemeinsamen Schuld bekannten sich jene österreichischen Autoren, die sich noch vor der Begriffsklärung rund um Kurt Waldheim mit der braunen Vergangenheit befaßten. Hans Lebert, der 1960 mit dem Roman Die Wolfshaut die Leichen in den Kellern eines österreichischen Dorfes mit dem sprechenden Namen Schweigen aufgespürt hat, machte in seinem zweiten Buch Der Feuerkreis (1971) ein Geschwisterpaar zur Allegorie des österreichischen Volkes: Er ist der Patriot, der emigriert und als Captain der englischen Armee in seine Heimat zurückkehrt, sie symbolisiert, wie Lebert sagt, »die im Jahre 1938 Schuldiggewordenen. Denn eine Kollektivschuld besteht [...]. Die Majorität des österreichischen Volkes ist damals schuldig geworden.«(4) Das Ende des Romans führt eine Bekehrung und Erlösung vor, die in Lernets Germanien schon angedeutet scheint: Die Schwester bekennt sich zu ihrer Schuld, und der Bruder nimmt sie auf sich, indem er die Schwester opfert, indem er seine Unschuld aufgibt.
In sakralen Bildern denkt auch Lernet, der zu Beginn seines Gedichts das Opfer beschwört und den »gewaltige[n] Altar, / Germanien, erschlagner Heere Gruft« (G 53). Der Sprecher des Gedichts redet weniger als Elegiker denn als Prophet. Er predigt in biblischen Anklängen (»der Geringsten einer«, G 57) und Umkehrungen (»Wenn man / euch richtet, richtet nicht«, G 57). Er redet seiner Herde ins Gewissen. Und da fällt in dieser zentralen Strophe auf, daß mitten drin die Anrede in der zweiten Person Plural aufgegeben wird, für jenen einen Satz, der die Schuld abhandelt: »Weil keiner sich von allen gegen die / gemeinsame, die ungeheuere, / erhob, war jeder schuldig« (G 57). Nicht »von euch«, sondern »von allen«: Fast unmerklich ist so auch der Sprecher in den Kreis der Schuldigen einbezogen.
In seinem Aufsatz »›Germanien‹ nach Auschwitz« hat Michael Pein hingegen zu Lernets Gedicht festgestellt: »Von einer Abrechnung mit den Irrtümern und Verbrechen der NS-Zeit kann keine Rede sein, obwohl kritische, auch selbstkritische Reflexionen für eine demokratische Entwicklung der Nachkriegszeit unverzichtbar sind.« (5) Weshalb konnte ein Todfeind der Nazis, ein Major der Sowjetarmee, wie Hugo Huppert einer war, das vor gut fünfzig Jahren ganz anders sehen? Oder auch Franz Theodor Csokor, Emigrant aus Überzeugung, der als eine der repräsentativen Figuren im Kulturleben der Zweiten Republik nicht links außen, sondern links der Mitte stand - er schrieb in einer Würdigung zu Lernets 50. Geburtstag 1947 über Germanien: »Viel wurde über die deutsche Katastrophe schon ersonnen und geschrieben, aber noch nichts geformt, das in solche Tiefe langt. Es ist eine große Abrechnung, wie sie nur ein Dichter strengster Zucht wagen darf.«(6) Peins Kritik hat eine ideologische und eine ästhetische Stoßrichtung: Offenkundig aber erregte das Gedicht zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung weder in der einen noch in der anderen Hinsicht Anstoß, das heißt: nicht in linken bzw. antifaschistischen Kreisen. Die Kritik, die kam, kam von rechts und konnte natürlich nur vorsichtig, auf dem eben erst abgesteckten Boden eines demokratischen Konsenses geäußert werden. In einem Brief spricht Lernet von »Angriffen und Denunziationen auf Grund von ›Germanien««, er habe »jedoch nichts davon vor Augen bekommen«. An Emil Lorenz schreibt er, es sei unter den Deutschen von einer Zerknirschung keine Spur. Soweit ich auf die Reaktion auf ›Germanien‹ schließen kann (die Radios senden's und geben den Hörern Raum zu Diskussionen), denkt fast niemand daran, die Ursachen des Übels in sich selbst zu erforschen, sondern alle Welt scheint überzeugt, die Niederlage Deutschlands sei ein ›Saupech‹, nichts weiter, alles wird nur vom Standpunkt einer geradezu grotesken Oberflächlichkeit beurteilt, und im ganzen zum geistigen Pöbel gewordenen Volke bereitet sich nichts vor als der Wunsch zur Revanche? (7)
Bekennende Nazis konnten nicht öffentlich widersprechen: Die, denen Lernets lyrische Zuchtrute galt, konnten sich, so knapp nach dem Krieg, nur ducken. Das Gedicht war also seiner Zeit durchaus gemäls. Sehen wir uns näher an, inwiefern.
Lernet setzte unter das lange Gedicht ein Datum, auf lateinisch, mit römischen Ziffern: »D.VIII.mens.Mai.MCMXXXXVI«, den 8. Mai 1946 (G 63). Das ist zunächst ein Signal der Historisierung, der Einordnung der nationalsozialistischen Episode sub specie historiae. Lernet wählte den Jahrestag des Kriegsendes für ein erstes Resümee. Der 8. Mai war freilich nicht wirklich der Tag der Fertigstellung. An Sándor Hartwich schreibt Lernet am 10. Mai, er »arbeite sehr viel an einem langen Gedichte, Germanien [...]. Ich plage mich Tag und Nacht mit dieser Marmorarbeit. « In den kommenden Wochen schloß er sein Projekt quasi auf neutralem Boden, in der Schweiz, ab: »Ich habe in Zürich unvorstellbar gearbeitet, was mir ein wenig erschwert war durch Besoffenheit nach Empfängen.« (8)
Wie Michael Pein bemerkt, mußte allein der Titel, der »einen von den Nationalsozialisten korrumpierten Mythos« zitiert, Aufsehen erregen. (9) In einem Brief an Peter Suhrkamp interpretiert Lernet das Gedicht auch als Antwort auf Suhrkamps Verwunderung, seinen, Lernets, Namen nicht »unter denen der Wiedererbauer Österreichs zu finden. Statt dessen - dieses Gedicht mit diesem Titel ... [...]; jetzt, wo die meisten sich treiben lassen, mache ich mir's noch unbequemer, als indem ich tätig wäre, - ich denke, und spreche das Gedachte aus (10). Im ersten Jahr der Zweiten Republik wendet der österreichische Schriftsteller Lernet-Holenia seine Aufmerksamkeit nicht seiner wiedererstandenen Heimat,
sondern noch einmal ganz Germanien zu. In einem Brief an Ernst Schönwiese bedauert Lernet, daß er dem »Produkt« nicht die »wirklich würdige Form, nämlich die hymnische«, habe geben können, »sondern ich habe, wie bei einer Volksrede, auf die Blankverse zurückgreifen müssen, die unserer Sprache im Grunde so ungemäß und künstlich anerzogen sind wie dem Pferde der Trab. Denn wer dächte nicht, über der kleinen Arbeit, an das Hölderlin'sche »Germanien«. (11)
Nun, Michael Pein denkt in seiner Studie kein einziges Mal daran. Hätte er es getan, dann hätte er den vom Autor bewußt wahrgenommenen, ja erlittenen Abstand zur poetischen Welt Hölderlins bemerken müssen, dann wäre sein Diktum vom »pompöse[n] Traditionalismus« des Gedichts (12) wohl nicht zu halten gewesen. Wie Rüdiger Görner gezeigt hat, ist es nicht nur im Thema, sondern auch in seiner Tiefenstruktur auf Hölderlins Elegie bezogen, ist es eine Art Zwiesprache. (13) Und daß Lernet sich des Blankverses (seit Shakespeare der Vers der dramatischen Rede) bedient anstatt der griechischen Metrik, das verdankt sich nicht technischem Unvermögen, sondern der schmerzlichen Einsicht in den substantiellen Unterschied - der Gegenstand erfordert für ihn eben gerade ein Abweichen von der Tradition:
Wie anders aber hat nun diese Anrede an die Nation, in dem Augenblicke, in welchem sie wirklich notwendig geworden war, - wie anders hat sie müssen gehalten werden, als Hölderlin sie, vorzeiten, gedacht! Zwischen den ›Feiertagen der Priesterin, die, wehrlos, Rat gibt rings den Königen und den Völkern‹ und dem Verse ›Zur Wut des Pöbels wandle sich die Macht der Könige‹ [aus Germanien, D.S.] liegt die ganze Schrecklichkeit des Endes einer Welt, - und es ist nicht meine Schuld, daß ich so habe reden müssen, sondern es ist die Schuld jener, in deren Hände das Erbe des Abendlands gelegt gewesen war und die, heute, noch immer nicht hören wollen, daß sie es veruntreut haben. (14)
Das schreibt Lernet am 27.2.1947 an Ernst Schönwiese. Wörtlich heißt es bei Hölderlin am Schluß, die Götter, »die Unbedürftigen«, seien gerne »Bei deinen Feiertagen, / Germania, wo du Priesterin bist / Und wehrlos Rat gibst rings / Den Königen und den Völkern« (15). 1801, als Hölderlins Hymne entstand, existierte das Heilige Römische Reich deutscher Nation noch. Seiner Idee des Nicht-Nationalstaatlichen, sakral Begründeten sah Lernet-Holenia sich verpflichtet. Daß die Habsburger über Jahrhunderte bis zuletzt auch den deutschen Kaiser stellten, hat das Bild, das Lernet von der deutschen Nation hatte, zweifellos geformt. »Das Reich, das einst die Welt war, sei verflucht!« sagt er im Gegenzug zu Hölderlin,
und die in der ersten Strophe entwickelte Vorstellung von Germanien als einem Altar, auf dem geopfert wird, nimmt er in der zweiten zurück, mit einer Anspielung auf die einstigen Auswirkungen des päpstlichen Bannes (wobei mit »dem nichterschollnen Donner Roms« wohl auch das Schweigen Pius XII. zu den Greueln des NS-Regimes gemeint ist): »es wandle sich kein Gott in Brot und Wein!« (G 53) Die Verweigerung der Eucharistie für die Gebannten ist wiederum, Rüdiger Görner hat darauf hingewiesen, (16) eine Reverenz gegen Hölderlins Elegie Brot und Wein.
Die »imperiale Idee eines ›Reichs‹«, die in Germanien nicht wirklich verabschiedet werde, ist Michael Pein höchst suspekt, (17) und zwar - das sei ausdrücklich eingeräumt - nicht ohne Grund. Denn Lernet-Holenia selbst hat sie in seinem Roman Die Standarte ambivalent interpretiert: Das Reich, der Erbe des Heiligen Römischen Reiches, ist da Osterreich, der Vielvölkerstaat, und der geht seinem Ende entgegen. »Wir haben dieses Heer, dieses Reich zusammengehalten, solange wir konnten«, sagt der k.u.k. Offizier Anschütz. Und über die auseinanderstrebenden slawischen Völker: »Wir haben ihnen alles gegeben, was wir ihnen geben konnten. Das ist die Pflicht der Deutschen. Wir haben sie mündig gemacht. Nun streben sie wieder von uns fort. Das ist das Recht der Nationen. Als Deutsche haben wir unsere Mission erfüllt.« (18) Am Ende des Romans jedoch sieht Fähnrich Menis in den Flammen, die die Feldzeichen verschlingen, einen »Wald von Fahnen und Standarten« wieder auferstehen. »Es waren [...] nicht mehr die alten Fahnen mit den typischen Bordüren aus rotweißen und schwarzgelben halben Rauten, es waren neue. Es war ein ganzer Wald, und sie standen über dem ganzen Volk.« (19) Das kann man 1934, ein Jahr nach Hitlers Machtergreifung, gar nicht anders deuten denn als Wald von Hakenkreuzen - im Kontext des Romans eindeutig eine tröstliche, verheißungsvolle Vision. Ganz offensichtlich hat also die emotionale Bindung an die alte Reichsidee Lernet selbst dazu verführt, mit der Möglichkeit, das Dritte Reich in seiner idealen Verwirklichung könnte eine Fortsetzung darstellen, zumindest zu liebäugeln - wenn man die Passage nicht als bloße Anbiederung an ein völkisch erwachtes Publikum lesen will. In dem bekannten Brief an Gottfried Benn aus dem Jahr 1933 finden sich widersprüchliche Signale: Zwar überwiegt Lernets Kritik an der »national-kollektivistische[n] Komponente« der Ereignisse in Deutschland, zugleich bekennt der Österreicher sich aber zum deutschen Volk und zur »Nation«. (20)
Den Verdacht, es sei enttäuschte Hoffnung zumindest mit im Spiel gewesen, legt des weiteren eine programmatische Passage in Lernets 1948 erschienenem Roman Der Graf von Saint-Germain nahe, eine Passage, die wie eine prosaische Erläuterung des in Germanien lyrisch Verdichteten anmutet - und zugleich wie eine Prophezeiung post festum. Denn alles, was vom historischen Standort im Jahr 1938 gesagt wird, ist ja zehn Jahre später bereits Geschichte. Der Ich-Erzähler spricht da vom Verrat, der in Österreich knapp vor dem Anschluß »hinter jeder Planke« lauere »und den Gedanken des wirklichen Reiches unter die Füße tritt« (21). Mit den Motiven der anschlußlüsternen Österreicher decouvriert Lernet wohl auch eigene Gefühle, k.u.k. Phantomschmerzen sozusagen: »Man wünscht hier, scheint's, wieder ein Weltreich zu spielen. Aber die Zeit dazu ist vorbei, auch für die Deutschen selbst [...]. Das Schicksal beruft nur einmal zur Herrschaft über die Welt.« Seinen Ruf bilde man sich allzu leicht ein: »Es sind nur noch täuschende Stimmen, die rufen« (22), Stimmen, so kann man mutmaßen, die Jahre zuvor auch Lernet-Holenia getäuscht oder wenigstens verunsichert haben. So scheint denn auch Hitler, ungenannt, als ein jeder historischen Sendung Unwürdiger auf: »[W]enn er wirklich wüßte, was das Reich gewesen ist, [...] so täte er nicht, was er tut - nicht einmal er täte das.« Hitler verwechsle das Reich mit dem Staat, Staaten seien aber stets nur »für sich selbst vorhanden« gewesen, »nie für andre. Ein Reich aber ist da für alle.« (23)
Was fast schon wieder wie eine Gedichtzeile klingt, verweist auf die Verse in Germanien, die Apostrophe: »Wer / errettet nun, da du die Welt vertan, / die Welt? Um welche Mitte schließt sich noch / der Erdkreis?« Und: »nicht dies, daß du dahin bist, - aber daß / du dich und was an dir gehangen hat, / verraten, selbst dein höchstes Amt, das Reich, / ist mehr als Schrecken, mehr als Untergang« (G 54). Und das Gewitter an Negationen, das eine ganze Strophe lang auf diesen Vers folgt (»So fiel nicht Troja zwei Mal, wie du zwei / Mal fielst, hob sich der Brand aus Pergamos / nicht wie aus dir« (G 55)) unterstreicht noch die Einmaligkeit des Geschehens im mythischen Kontext: Das hier hat eine andere Qualität.
Es geht bei dieser Klage um das verspielte Reich nicht, wie Michael Pein argwöhnt, um den »Verlust von Herrschaft« (24), sondern um den Verlust eines geistigen Angelpunkts, eines Koordinatensystems, einer Selbstversicherung im historischen Mythos - denn das Zweite, das Heilige Römische Reich hat es auch vor dem Dritten längst nicht mehr gegeben, es sei denn als Idee. Diese sieht Lernet durch den Nationalsozialismus verraten, und verraten sieht er ganz offenkundig auch sich persönlich, als einen, der an ihr »gehangen«. Pein zeigt sich begreiflicherweise davon irritiert, daß das Exzeptionelle der Naziherrschaft, das, was »mehr als Schrecken, mehr als Untergang« ist, in Germanien nicht die Judenvernichtung meint, ja daß diese »gar nicht das Zentrum« des Gedichts darstellt. (25) Darin steht aber auch der Satz: »Es / gibt Taten, die so ungeheuer sind, / daß keine Sühne hilft« (G 61). Der traditionelle, der mythische Zusammenhang von Schuld und Sühne ist hier außer Kraft gesetzt. Natürlich bezieht sich die Einzigartigkeit der NS-Verbrechen in Germanien auf die ›Endlösung‹.
Lernets Gedicht ist aber in gewisser Hinsicht tatsächlich eines der Täter. Es nimmt, bei allem erhöhten Standort, ihre Perspektive ein, es geht aus vom zerstörten Deutschland, vom Zusammenbruch eines Reichs, vom Zusammenbruch der Fundamente einer Kultur. Diese Sicht war den Zeitgenossen durchaus nahe: In der gegen Ende des Krieges und knapp danach verfaßten Lyrik standen die Deutschen im Mittelpunkt, ihre Hybris, ihr Versagen. Die Millionen der KZ-Opfer befanden sich gleichsam noch im Schatten der Millionen Gefallenen.
Auch das ästhetische Ärgernis, das Lernets Gedicht für viele heutige Interpreten darstellt, ist vor diesem Zeithorizont zu sehen. Pein interpretiert die peinlich genaue Einhaltung des metrischen Schemas (die so peinlich genau gar nicht ist) als Symptom des Eskapismus und stellt außerdem »Konnotationen von einschüchterndem Sprechen« fest. (26) Einschüchternd sprechen, in einem anderen Sinn, war freilich genau das, was Lernet hier wollte: In einem Brief an Peter Suhrkamp erklärt er zum Prinzip der zehnsilbigen Blankverse (elfsilbige würden unbetont, also weiblich enden): »Die fortlaufenden männlichen Schlüsse verleihen den Versen zwar eine bedeutende Wucht, sind aber sehr schwer zu schreiben gewesen.« (27) Um 1945 war der Glaube an die Wucht des Rhetorischen in der Lyrik noch weit verbreitet, und vielen schien das Pathos der von millionenfachem Leid bestimmten Lage angemessen.
Beleuchtet man die Situation der österreichischen Lyrik nach dem Kriegsende, liegt es nahe, den thematischen Fokus in einem dazumal sehr prominenten Dichter zu suchen, der nach 1945, schon als Toter, in der Literaturszene heftige Auseinandersetzungen ausgelöst hat: Josef Weinheber. Er beging, nachdem er und die Machthaber einander wechselseitig zu höchsten Weihen verholfen hatten, knapp vor Kriegsende, am 8. April 1945, Selbstmord.
Als 1947 Weinhebers Nachlaßband Hier ist das Wort erscheint, entfacht die katholische Zeitschrift Der Turm mit dem Abdruck einiger Gedichte eine Debatte über die Frage, inwieweit der Dichter durch politischen Irrtum, politische Schuld diskreditiert sei, auch darüber, ob sein Freitod als Sühne zu betrachten sei. Neben Franz Theodor Csokor, Felix Braun, Theodor Kramer und anderen wird auch Alexander Lernet-Holenia zur Stellungnahme eingeladen. Sie lautet:
Weinheber war ohne Zweifel der bedeutendste Lyriker seiner Zeit, zumindest
was das Formale anbelangt; und man kann von einem solchen Talent nicht noch ohneweiters die rechnende Vernunft des Bürgers oder den Genius des Sehers erwarten. Es ist möglich, daß er mit seinem Selbstmord das Konto seiner Irrtümer hat glattziehen wollen. In diesem Falle käme seine Tat einer Überschätzung seiner Person und ihrer Wirkung und einer Unterschätzung des Lebens gleich, das ihm von Gott geschenkt worden war. Aber es kann, was er getan hat, auch andere Gründe gehabt haben. [...] Wir sind allzu sehr geneigt, die Vorwände für Ursachen zu nehmen. Jedenfalls aber wäre nicht einzusehen, warum Weinhebers inhaltlich verhältnismäßig harmloses, sprachlich großartiges Werk der Öffentlichkeit entzogen bleiben sollte. (28)
Bemerkenswert ist nicht nur die literarische Einschätzung Weinhebers, mit der einschränkenden Hervorhebung des Formkünstlers, sondern auch die Aussage, dessen Werk sei ein »inhaltlich verhältnismäßig harmloses« gewesen. Lernet muß gewußt haben, daß dem keinesfalls so war: Weinheber hat Hymnen auf den Anschluß, auf den Führer und auf den Bau der Reichsautobahn sowie einen »Hochgesang auf den deutschen Rüstungsarbeiter« verfaßt. Sein »Hymnus auf die Heimkehr« (»Dies im Namen des Volks! / Dies im Namen des Bluts! / Dies im Namen des Leids!« (29) scheut nicht vor Pindarischen Strophen zurück. Hitler wird darin mit Odysseus gleichgesetzt und Hölderlin ungeniert als Zeuge aufgerufen, dessen Sehnsucht nun endlich erfüllt sei: »Stünde doch Pindar auf / oder des Vaterlands / dreimal heiliger Mund: / Hölderlin! Hölderlin! / Daß er sagte, was not / tut zu sagen mit Macht: / Das geeinigte Herz/ und die Größe der Pflicht/ und die Fülle des Reich -«. (30)
Weinheber, der Klassizist, hat das, was Lernet heilig war, in seiner Substanz beschädigt, hat dessen literarische Hausgötter förmlich in den Schmutz gezogen. Lernet hat wohl gespürt, daß die Tradition abendländischer Dichtung insgesamt von ihrem Mißbrauch betrotten ist und ging deshalb einer kritischen Auseinandersetzung mit Weinhebers »Formkunst« aus dem Weg. Die Wirkung als Hymniker, um die es Lernet nach 1945 zu tun war, war durch dieses schlechte Vorbild akut bedroht. »Wenn ich wirken will, so will ich es ad majorem Germaniae gloriam«, schrieb Josef Weinheber, Ehrendoktor der Alma mater von Nazis Gnaden, an den Wiener Gaustudentenführer im Jahr 1944, (31) als er längst unter der eigenen Willfährigkeit litt. Daß der, der den Ruhm Germaniens vermehren wollte, seine Schande vergrößert hatte, war Lernet gewiß bewußt, und bewußt war ihm auch die Verantwortung des Dichters. Schließlich sollte sein Gedicht Germanien ursprünglich »Den Manen Gerhart Hauptmanns« gewidmet sein, wie er Schönwiese schreibt. (32) Weinheber hatte sich im Dritten Reich freilich wesentlich intensiver kompromittiert als Hauptmann.
Die Gedichte, die er in dem Abschnitt »Das Bekenntnis« hinterlassen hat, sind mehr noch als von Selbstanklage von Wehleidigkeit geprägt - nicht er, die Zeit sei an allem schuld: »Ich aber klage an, / weil ich im Sündenfalle / nichts Schuldiges hab getan.« (33) Weinheber nennt sein Schicksal »stolzes Martertum« (34) und spricht sich jeden Handlungsspielraum ab: »Niemals vorher war / einer so Volk. Und Volk ist Duldertum, / und ich ein Dulder, den das Volk gebar. / Was will die Zeit von mir? Ward mir Gebühr? / Geehrt hat mich die Macht, doch nicht gefragt. « (35) Am ehesten »Bekenntnis« ist noch das erste Gedicht des Zyklus Mit fünfzig Jahren, in dem Weinheber auch in der Form auf Koturnen verzichtet. Darin heißt es:
Vielleicht, daß einer spät,
wenn all dies lang' vorbei,
das Schreckliche versteht,
die Folter und den Schrei -
und wie ich gut gewollt
und wie ich bös getan;
der Furcht, der Reu gezollt
und wieder neuem Wahn -
und wie ich endlich ganz
dem Nichts verfallen bin
und der geheime Kranz
mir sank dahin. (36)
Die Weinheber-Debatte ergriff bald auch andere österreichische Zeitschriften, Otto Basils Plan und das Österreichische Tagebuch. Vor allem aber reagierten einige Lyrikerkollegen in ihrer, in Weinhebers Sprache: im Gedicht. Theodor Kramer, von dem Lernet Gedichte auswendig wußte, (37) schrieb, unmittelbar nach Weinhebers Selbstmord, in der englischen Emigration das »Requiem für einen Faschisten«: »Du warst in allem einer ihrer Besten, / erschrocken fühl ich heut mich dir verwandt«, sagt der Jude, Sozialdemokrat und bekennende Anti-Klassizist Kramer über seinen Kollegen, der ihn stets wütend und mit antisemitischem Vokabular attackiert hat. Weinhebers Verirrung und sein Tod seien auch seine, Kramers, Schuld, denn »unser keiner hatte die Geduld, / in deiner Sprache dir den Weg zu sagen« (38). Kramer setzte beim kommunistischen
Wiener Globus-Verlag durch, daß das »Requiem« in seinen 1946 erschienenen Band Wien 1938 / Die grünen Kader aufgenommen wurde.
Im Gegensatz zu Kramer befleißigten sich die übrigen Nekrologen eines der Gedichtsprache des Verblichenen mehr oder minder angepaßten Tones. Ernst Waldinger, einstmals einer der besten Freunde Weinhebers und einer der wenigen jüdischen Autoren, die dieser schätzte, nannte seinen im amerikanischen Exil - ebenfalls in Blankversen - geschriebenen Nachruf »Der falsche Prophet«. Waldinger wirft ihm darin vor, daß er in seinem Loblied auf die Heimkehr des Saarlandes ins Reich (1935) sich ausgerechnet bei den Psalmen bedient habe:
In deinen Häusern wirst du wohnen, wie zuvor,
so sprachst du, dein und ihrer schamlos spottend.
Du brauchtest des Psalmisten Ton und Wort
In jener Stunde, da sein altes Volk
Aus Häusern, drin sie tausend Jahre saßen
Von jenen, denen du den Hüttenfrieden,
Den Frieden des Millenniums versprachst,
Vertrieben ward, so daß der bittre Satz
Vom Menschensohn, der keine Bleibe hat,
Im Reiche der Barbaren wieder wahr ward. (39)
Waldinger selbst hatte für den Gebrauch traditioneller Formen durchaus etwas übrig: Hier jedoch waren sie für ihn glatter Hohn. Er war seinerzeit von Weinheber, der sich selbst als den »Griechen« sah, als der »Lateiner« apostrophiert worden.(40) Dennoch warf er ihm in einem späteren Gedicht - »Schlaflose Stunden. Den Manen Josef Weinhebers« - die Hohlheit seiner Formen vor: »Ach, deiner Räusche bittern Bodensatz, / Den Sumper, der als Helden sich maskierte, / Den Wurstel bargst Du in dem schweren Prunk / Der Toga deiner Oden; eitel sind sie.« (41)
Einen besonders nachsichtigen lyrischen Nachruf hat übrigens ein anderer politisch Linksstehender verfaßt, Wyston Hugh Auden, der sich wie Weinheber, nur Jahrzehnte später, im niederösterreichischen Kirchstetten angesiedelt hatte. (42) Er wählt im Englischen die antikisierende Ode als die Weinheber adäquate Form.
Bereits 1947 erschien im Münchner Alber-Verlag Wilhelm Szabos Gedichtband Das Unbefehligte. Szabo, Linkskatholik, Funktionär der Vaterländischen Front, von den Nazis als Hauptschullehrer entlassen, war als Lyriker von Weinheber protegiert worden. Sein Band Im Dunkel der Dörfer hatte es ab 1940 zu mehreren Auflagen gebracht. Szabo, der Paradefall eines »inneren Emigranten«, verstand den Band mit dem programmatischen Titel als lyrisches Fazit der Nazizeit: Er wendet sich darin vom schlichten Volksliedton seiner früheren Bücher ab und dem
Klassischen zu. Ein langes fünfteiliges Gedicht mit dem Titel »An einen toten Dichter« war offenkundig an Weinheber gerichtet: »Uralter Makel der Fahrenden, anhaftend oftmals dem Sänger! / Ach, gern befehligen wollen sein Lied die Mächtigen«. - Fast scheint es hier, als wolle Szabo dem toten Meister beweisen, daß auch er imstande sei, Hexameter zu verfassen. In der Bildlichkeit des Gedichts tritt der NS-Dichter als mittelalterlicher Minnesänger auf: »Er, ach, Tellerschlecker der Macht, er / münzt um der Brosamen willen vom Tische der Hohen / zu Medaillen das Lob das unveräußerliche, das / Gold seiner Gabe.« (43)
Im Streit um Josef Weinheber findet die unmittelbare intellektuelle Auseinandersetzung nach dem Krieg in Österreich einen ersten Kulminationspunkt. Bereits Anfang der 50er Jahre beginnt die Re-Inthronisation des gestürzten Regenten, nicht ›trotzs Weinhebers NS-Verstrickung, sondern unter völligem Stillschweigen darüber setzt man ihm die »späte Krone« des Österreichischen Klassikers auf, wird er schulbuch- und feiertauglich. In Weinhebers Windschatten hoffen seine Trabanten auf Rehabilitierung: Sein Haus- und Hofgermanist Josef Nadler veröffentlicht eine Österreichische Literaturgeschichte (Roman Roek hat den »Fall Nadler« und Lernets zwiespältige Haltung dazu beleuchter (44). 1950 legt die einstige crème de la crème des braunen Literaturbetriebs von Alverdes bis Vesper ein demonstratives »Bekenntnis zu Josef Weinheber« ab. (45)
Hält sich Lernet-Holenia aus dieser Debatte in ihrer personellen Zuspitzung (wie ich meine, aus substantiellen, die eigene Poetik in Frage stellenden Gründen) auch heraus, so konstatiert er die entsprechenden Tendenzen bereits in den ersten Nachkriegsjahren: In einem Brief an Peter Suhrkamp wundert er sich 1946 darüber, daß Künstler der NS-Kultur wie Herbert Boeckl und Max Mell schon wieder als »Kulturträger auf der neuen Suppe« schwimmen. (46) Und an Schönwiese schreibt Lernet am Heiligen Abend des Jahres 1947, es sei ganz falsch, »daß man
jetzt willens ist, alles, was aufs Konto des Dritten Reiches geht, vergeben und vergessen sein zu lassen, bloß weil man einen dämlichen Autokonstrukteur oder einen Finanzgauner aus jener Zeit zur Mitarbeit heranziehen will [...]. Aus Schuld wird immer nur wieder Schuld.« (47)
Die einzelnen Stimmen aus dem Chor der lyrisch Resümierenden zeigen, daß der hohe Ton der Klage und Anklage nach dem Krieg noch nicht obsolet war, ja daß manche, wie Szabo, ihn erst jetzt für sich entdeckten, quasi als bewährtes Mittel im Falle historischer Katastrophen: »Wähnt nicht gebannt die Dämonen! / Ihr bergt sie in Truhe und Schrein. / Ihr hegt sie im Kinde. Sie wohnen / euch dunkel und unerkannt ein.« (48) Sichtbar wird außerdem, daß der Massenmord an den Juden in den Abrechnungen dieser Zeit noch nicht im Zentrum stand - auch nicht bei Michael Guttenbrunner, mit dem Lernet-Holenia sich in den 50er Jahren eng befreunden sollte. Guttenbrunner setzte sich als Sozialdemokrat und als ebenso widerwilliger wie widerspenstiger Soldat in seinen ebenfalls der Tradition verpflichteten Bänden Schwarze Ruten (1947) und Opferbolz (1954) vor allem mit dem Krieg auseinander.
Wenn Robert Menasse gemeint hat, in Österreich habe es »nach 1945 keine relevanten Versuche gegeben, die Erfahrungen mit Faschismus, Krieg und der sogenannten ›Stunde Null literarisch aufzuarbeiten« (49) (die Neuauflage von Mars im Widder 1947 läßt er ausdrücklich nicht gelten), dann hat er mit der Einschränkung »relevante« eine Sicherung eingebaut, man wird die Behauptung aber doch relativieren müssen. Alle die genannten Lyriker waren durchaus renommiert und die meisten über die Zeitschriften Plan und silberboot auch dem lesenden Publikum präsent.
Theodor Adornos Totschlagwort vom barbarischen Gedichteschreiben nach Auschwitz gegen Lernet zu verwenden, wie Michael Pein es tut, und diesen dann gegen Paul Celan auszuspielen, halte ich für keine glückliche Idee: Auch Celan fühlte sich durch Adornos Verdikt irritiert, auch bei Celan wird »Auschwitz nicht genannt« und auf den Holokaust »lediglich angespielt«, (50) Celans erster, 1948 in Wien erschienener Gedichtband Der Sand aus den Urnen ist durchaus traditions- und mythosgesättigt und huldigt einem gehobenen Ton: Das Eingangsgedicht »Ein Lied in der Wüste« zitiert ritterliche Wehrhaftigkeit: »Ein Kranz ward gewunden aus schwärzlichem Laub in der Gegend von Akra: /
dort riß ich den Rappen herum und stach nach dem Tod mit dem Degen. Auch trank ich aus hölzernen Schalen die Asche der Brunnen von Akra / und zog mit gefälltem Visier den Trümmern der Himmel entgegen.« Und weiter unten: »Zuschanden gehaun ward der Mond, das Blümlein der Gegend von Akra: / so blühn, die den Dornen es gleichtun, die Hände mit rostigen Ringen.« (51) Auch hier spricht einer von einer Verwüstung, einer Wüste - aber eben als Opfer der Geschehnisse. So weit, wie Pein suggeriert, sind diese Verse von denen Lernets am Schluß von Germanien aber auch wieder nicht entfernt: »Was drängt ihr euch
mit blinden Augen, mit / verzerrten Lippen, rostendem Gerät, / zerrißnen Bannern, ein unendliches Gewimmel?« (G 63)
Wenn man nun auch dem fundamentalen Einspruch Michael Peins gegen Lernets Elegie Germanien widersprechen will, so sollte man andererseits den kritischen Ansatz jedenfalls in zweierlei Hinsicht fruchtbar machen: Was Pein als »Kälte« diagnostiziert, die »den Bereich menschlichen Leids verdrängt« (52), läßt sich an einer Beobachtung festmachen: Wann immer im Gedicht die Verbrechen des Dritten Reichs aufgezählt werden, steht Materielles, steht das Sichvergreifen an Hab und Gut an erster Stelle - das Dritte Reich »verzehrte sich vor Habgier«, »preßte bei«, »raffte«, »trog«, »verhehlte das Erraffte, schändete den Raub noch« heißt es zuerst, ehe der Tod vorkommt, der auch gefälscht gewesen sei; gemeint ist wohl jener im KZ (vgl. G 54). Und an anderer Stelle nennt das Gedicht, eben wiederum in dieser Reihenfolge, »den Raub an anvertrautem Gut, den Mord / am Blute, das Jahrhunderte zu Gast / war, an dem fremden und am eignen Blut« (G 61): Hier zeigt sich in der Tat ideologische Befangenheit, eine Verfangenheit in der deutsch-nationalen Gedankenwelt, in der Außensicht: Denn wie sollte, was, wie das deutsche, wie das österreichische Judentum, »Jahrhunderte zu Gast war«, noch fremd sein können?
Friedrich Torberg hat diesen blinden Fleck in Lernet-Holenias Weltbild in jenem Jahr 1947 offenbar mit feinem Spürsinn erkannt und auch das Anrüchige an dessen Insistieren auf der Behauptung vom »Rückfall der Deutschen in das Slawische«. Als ungemein gewitzter Briefschreiber pariert er Lernets entsprechende Bemerkung indirekt: mit einem Hinweis auf den ähnlich argumentierenden Ernst Wiechert (Hitler als »böhmischer Landstreicher« im »heiligen Haus der deutschen Nation«) - Torberg dazu: »Was sich da alles an Rückfall abspielt, kann man so geschwind gar nicht ausloten.« (33)
Der zweite Hinweis Peins, den es zu beachten gilt, betrifft die feudale Prägung der lyrischen Vorstellungswelt: Sie ist in diesem Gedicht, das vor »Herren« und »Knechten« und »Pöbel« und »Abschaum« nur so wimmelt, nicht zu leugnen. Allerdings verkennt Michael Pein die Durchlässigkeit der Begriffe, das Spiel mit der Umkehrung, das Lernet, ganz im Sinne des Hegelschen »Herr und Knecht«-Paradigmas, treibt. Schon die Staufer hätten Knechte über Edle gesetzt: »Und als zuletzt / der schlimmste Knecht kam, erbte er das Reich.« In diesem Dritten habe
es keine Herren mehr gegeben, keinen, »der nicht, zuletzt, / den Zaum, den er einst andern angelegt, / ins eigne Maul genommen«, Und, was dem Offizier Lernet wichtig ist und einem feudalen Ehrbegriff zuwiderläuft: Jeder der »Feldherrn« hat, im Sinne einer über das Buchstäbliche hinausgehenden Legitimität, mit dem Eid auf Hitler seinen Eid auf den Kaiser gebrochen (G 56). Die gerechte Empörung kommt zu spät und halbherzig: Weil auch die Herren des 20. Juli dem Knecht, dem
Gefreiten gedient haben: »Die Hände bebten und die Kniee bei / der ungeheuren Tat, die keine war.« Lernet spricht auch bei der Nicht-Tat von Schuld: »diese Schuld und alles andre Schuldsein!« (G 57).
Germanien attackiert das Pathos der Pflichterfüllung, die auf einer Pflichtverletzung gegründet ist: »Rühmt euch nicht, / daß ihr gehorcht, weil ihr nicht anders als / gehorchen können!« Nicht die Besatzung, mahnt der Sprecher des Gedichts, hat das Volk versklavt: »Rühmt / nicht, daß ihr Knechte seid! Ihr seid es längst / gewesen« (G 58f.). Michal Pein glaubt, die »Schuld« sei hier »vor allem Sache der Knechte. Jetzt, nach dem Untergang, müsse von den alten Herren erst einmal das Dienen richtig gelernt werden, womit ein ›Dienst‹ am ›Reich‹ gemeint ist.« (54) Das ist ein glattes Mißverständnis: Die Anrede gilt, mehrfach vorbereitet, allen Deutschen, »dem Volk, das Pöbel ward« (G 54): »Lernterst dienen, lernt es, euch / ergeben, seit ihr euch ergeben habt. / Man sagt zwar, daß ihr frei seid. Frei von wem? / Ihr seid die Knechte eurer selbst.« (G 59) In dieser Dialektik steckt die ganze Ambivalenz der »Befreiung«. Indem Lernet Herrenmenschentum und Knechtgeist in eins setzt, hält er seine feudale Logik gegen die der Volksgemeinschaft - und kann nicht verhehlen, daß beide obsolet sind.
In den in der letzten Strophe angerufenen »Schatten« meint Pein - trotz allem lyrischen Dementi - die Garanten für das Fortleben der Reichsidee zu erblicken. (55) Tatsächlich kehrt das mythologische Todesszenario der letzten Strophe (»ein einzig Grab«) wieder zu dem der ersten zurück: »Das ist nun dahin. / Nun schweigen die gewalt'gen Donner: Von / den blutgetränkten Hügeln wälzt sich das / Gewölke grollend fort« (G 63). Diese Conclusio setzt sich aber nicht nur vom deutschen »Zusammenbruch« ab, sie meint nicht nur »die Abgetanen und das Abgetane« (G 62) der jüngsten Zeit, sondern bezieht sich wörtlich auch auf die weiter oben ausgebreitete mythische Erzählung vom Weltenbaum (»ein heiliges Gewitter, ein gewaltiges Gewölk«, G 57), unter dem das Schicksal der Deutschen beschlossen worden sei. Schon in einer früheren Strophe ist, wiederum mit Hölderlins großer Vorlage korrespondierend, das Einst der mythischen Ordnung, aus der Deutschland sich selbst gestürzt hat, als Idylle um die Weltesche
Yggdrasyl angesprochen: »Einst heil'ger Dämmer, hohe Schauer! Einst / ein Weh'n und Weben des geweihten Laubs« (G 55). Das »waste land«, das Lernet am Ende des Gedichts ausmalt, (56) ist das Zwischenreich jener untoten Toten, die wir aus Lernet-Holenias lyrischem Werk gut kennen. »Krachend bricht die Schar, / die heil'ge, hin«, heißt es zuvor (G 55): Die antike »heilige Schar«, die Elitetruppe jener 300 jungen Thebaner, die untereinander durch Freundschaft (oder mehr) verknüpft, bei Chäroneia mit fliegenden Fahnen untergingen und gemeinsam bestattet wurden, der Inbegriff reinen, edlen Heldentums - sie wird auch in Hölderlins Germanien (57) zitiert (und in Kanton Schweiz). Die Widerrede gegen die Heroisierung folgt bei Lernet aber in demselben Gedicht: Der Sprecher wendet sich gegen jedes Helden- und Totengedenken: »Laßt, wenigstens, / den Toten ihre Ehre, tot zu sein« (G 60).
Ein Satz, über den Michael Pein sich entrüstet: Dem Holocaust zum Trotz »redet der Text ohne Probleme von der Ehre, tot zu sein« (58). Ein anderes Beispiel dafür, wie ein ideologisches Vorurteil den Blick trüben kann, ist Peins Interpretation der Verse der Schlußstrophe: »O Tag / des Endes, Tag der keiner war! O Nacht, / o leichenhafte Stille voller Lärm! / O abgestorbne Luft voll Stimmen! Habt / ihr, Schatten, nicht genug an eurem Ruhm?« (G 63) Pein meint, »O Tag des Endes, Tag der keiner war« deute an, »dass ein ›Tags bisher nicht wirklich war, als positive Wirklichkeit noch kommen könnte oder sollte«, nämlich, mutmaßt Pein, als Wiederkehr des Reiches. (59) Aus dem unmittelbaren Zusammenhang des Gedichts ergibt sich jedoch klar ein anderer poetischer Sinn: Der Tag des Untergangs wird zur Nacht. Der Schrecken des Dritten Reichs »taucht / den Tag der Welt in Nacht« heißt es an anderer Stelle in Germanien (G 56). Das liest sich wiederum wie eine Antwort auf Hölderlin, der in seinem Germanien das Aussprechen des Geheimen fordert: »Wo aber [...] ernst geworden ist der Zorn an dem Himmel, / Muß zwischen Tag und Nacht / Einstmals ein Wahres erscheinen.« (60)
So scheinen mir die Oxymora dieser Verse Lernets wiederum mit einem Oxymoron - oder Paradox - am besten beschrieben, das Rüdiger Görner gefunden hat: »hochgestimmter Nihilismus« (61). Es ist eine Stimmung, die sich auch in Gedichten wie »Aufklärung auf Komorn zu« findet. Der Dichter offenbart sich als einer, der, wie Michael Guttenbrunner in seiner prägnanten Charakteristik sagt, »hinter den Gefallenen zurückgeblieben war« (62) In Germanien vollzieht sich eine
Abkehr vom ritterlichen Kriegerideal, die Lernet sehr wohl wahrnimmt: »Volk, das nicht mehr lebte, um / zu leben, nur noch um zu sterben!« (G58) Lernet nimmt vorweg, was später zum common sense der Faschismus-Analyse gehören wird: den kollektiven Todestrieb, die Nekrophilie. Das Gedicht zeigt die selffulfilling prophecy all der germanischen Apokalypsen: »Das Ende wissen, ist / das Ende« (G 58).
Daß der Schicksalsbegriff im Zusammenhang mit den NS-Verbrechen ebenso anstößig ist wie die Vorstellung, das Böse sei letztlich nicht von dieser Welt, daß eine noch so gebrochene Herrenreiter-Mentalität heute Unbehagen auslöst, liegt auf der Hand. Unter den prominenten Zeitgenossen hat Ähnliches wohl nur Friedrich Torberg verspürt, der in seinen langen Briefen an Lernet aus diesen Jahren Germanien auffälligerweise nie erwähnt. Was der Emigrant, noch ohne Kenntnis des Gedichts, dem im Land Gebliebenen im Mai 1946 aus den USA schrieb, muß Lernet getroffen haben: »Nach dem letzten Krieg gab es noch wirklich Zusammengebrochenes (zum Beispiel Monarchien und Reichsgedanken) und wirklich aufrechte Gesinnungen [...]. Da war gut hymnisch werden.« (63)
Aber Lernet-Holenia war sich dieser Widersprüche ohnehin bewußt. Auf Einladung von Viktor Matejka erläuterte er im Österreichischen Tagebuch in einer längeren Abhandlung im Juli 1947 seine Behauptung, daß das Mittelalter in Wahrheit erst mit dem Jahr 1945 zu Ende gegangen sei, weshalb man nun in einem Zwischenreich lebe, in einem Vakuum, das es mutig zu nützen gelte: Die »ästhetisierende und moralisierende Geschichtsschreibung« gaukle vor, daß »historische Umwälzungen in würdiger, ja majestätischer Form geschähen«. Wer einmal eine Schlacht erlebt habe, wisse, daß dem nicht so sei. Und: »Es hat wenig Dinge gegeben, die kläglicher waren als der Zusammenbruch des Dritten Rei-
ches.« (64)
Man könnte sagen, daß Lernet dieser Erkenntnis in seinem Gedicht Germanien zugleich Tribut gezollt und ihr - durch die Sublimierung im hohen Ton - entgegengewirkt hat. Wie er den Mythos in dieser Zeit als Schicksal gedeutet hat, als »Mittelweg« zwischen dem abwesenden Gott und der entgötterten Natur, (65) so hat er, subjektiv, in diesem Gedicht einen höheren Auftrag erfüllt: »[E]s scheint mir, als hätt ich's nicht eigentlich geschrieben, sondern als sei's mir diktiert worden, und alle meine Anstrengung hat nur der metrischen Fassung, nicht dem Sinne gegolten, in bezug auf den ich nie schwankend war.« (66) So hat Lernet
anderswo bekräftigt: »Alles, was ich über die Zeit gedacht und zu sagen gehabt habe, ist im Gedicht ›Germanien‹ gesagt.« (67)
Michael Pein hat Lernet vorgeworfen, er trage mit dem Text sein Teil zum österreichischen Opfermythos bei. (68) Gedacht war es anders: »Ich bedaure keinen Augenblick, in dem Gedichte so scharf gewesen zu sein, - und wenn man's durchaus wissen will: es ist an die Osterreicher so gut wie an die Deutschen [...] gerichtet«, schreibt Lernet an Emil Lorenz. (69) Gegenüber Schönwiese meint er, dem Titel Germanien gemäß betreffe es »auch diejenigen unter uns, die sich dazu zählen«?. Explizit macht Lernet-Holenia seinen Vorwurf spätestens in dem Gedicht »An Österreich«, dessen früheste Fassung 1955 erschien. In seiner letzten Version endet es so:
Seit du, von deinen Söhnen ausgeliefert,
in einer einzigen Nacht dahingerafft,
verschwandest von den Karten, seit die Gnade
der Sieger dich zurück vom Abgrund riß,
dem ungeheuren Untergange Deutschlands,
wie wenig Ehrfurcht hast du vor dir selbst,
wie wenig vor dem Wunder, das du warst,
daß du dir nicht gestehen willst, es hätte
nur eines Federstrichs bedurft, und dein
auch war das gleiche Los, das Los der Deutschen!" (71)
Diese Unverblümtheit will so gar nicht zu dem in der Zeitschrift Der Turm publizierten Diktum aus dem Jahre 1945 passen, das dank Robert Menasse und Wendelin Schmidt-Dengler den Schriftsteller Lernet-Holenia für die Literaturgeschichte erledigt hat (wahrscheinlich ist er Tausenden Wiener Studenten tatsächlich bloß durch diesen einen Satz bekannt): »In der Tat brauchen wir nur dort fortzusetzen, wo uns die Träume eines Irren unterbrochen haben, in der Tat brauchen wir nicht voraus-, sondern nur zurückzublicken«. »Wir sind [...] unsere Vergangenheit« - dieser Succus machte Karriere und wurde nicht als Absage an den Nationalismus verstanden, sondern als Versuch der Restauration? Manfred Müller hat betont, daß Lernet privat keineswegs so gläubig in die Zukunft oder besser: die Vergangenheit blickte. (73) Und wirklich schreibt Lernet im Februar 1946 an Torberg: »wenn der Schutt fortgeräumt sein wird, wird nichts, oder fast nichts mehr da sein.« Obwohl man in Wien noch »ein paar Versuche mit veralteten Geistern« mache, stelle sich heraus, »daß offenbar auch der Krieg, mit all seinen Zerstörungen, nur ein sichtbares Zeichen der inneren Zerstörung gewesen ist«. (74)
Was Lernet im selben Jahr in einem Brief an Felix Braun formuliert, ist der komplette Widerruf seiner an den Turm gerichteten, staatstragenden Dichter-Adresse:
Es hat keinen Zweck, sich fortwährend vorzusprechen, das Heutige sei eben solchen Schwierigkeiten ausgesetzt, daß, wenn sie nur erst wegfielen, wieder ein Gestriges oder gar ein Zukünftiges daraus würde. Was ist, bleibt, weil das Frühere aufgehört hat; das Provisorische, das Flickwerk, die Ratlosigkeit, die Leere bleibt, weil die Fülle, das Lebendige, das Vollkommene, das Dauernde seine Zeit gehabt hat und nicht mehr dauert, sondern ganz hinübergegangen ist. Es ist uns nicht etwas ›passierts, sondern was sich längst vorbereitet gehabt, kommt heraus. Man schiebe nichts auf die Äußerlichkeiten, es kommt alles von innen aus uns her, auch das, was wir jetzt erleben. (75)
Lernets Germanien ist, trotz allen Rückfällen in die Reichsnostalgie, die öffentliche Kundmachung dieser privat artikulierten Desillusionierung - das Gegenwort zu jenem dem Dichter heute als Stereotyp anhaftenden Appell an eine rückwärtsgewandte Selbstgenügsamkeit. Das Gedicht ist ein Bekenntnis, ein ›Outing‹, und es verpflichtet den Leser von heute, es und seinen Autor zumindest ernst zu nehmen: »Seit ich Ihr ›Germanien‹ gelesen und immer wiedergelesen, weiß ich, Alexander Lernet-Holenia, daß Sie ein andrer sind als Sie zu sein vorgeben«, staunt der Kommunist Hugo Huppert. »Daß Ihre Nonchalance, Ihre Graf-Bobby-Attitüde und alles, was im Literarischen Ihr Sonderlingswesen ausmacht, gespielter Schein ist.« (76)
(1) Huppert 1947, S. 5.
(2) Lernet-Holenia 2001, S. 57. Im folgenden bezieht sich die Sigle »G« für Germanien plus Seitenzahl auf diese Ausgabe.
(3) Rosek 1997, S. 323.
(4) Böhm 1971. Vgl. Strigl 1997.
(5) Pein 1999, S. 249.
(6) Csokor 1947.
(7) Alexander Lernet-Holenia an Emil Lorenz, Brief vom 20. Feber 1947, zit. n.: Lernet-Holenia 1989, S. 651.
(8) Alexander Lernet-Holenia an Sándor Hartwich in Briefen vom 10. Mai 1946 und vom Juli 1946, zit. n. Lernet-Holenia 1989, S. 650.
(9) Pein 1999, S. 239.
(10) Alexander Lernet-Holenia an Peter Suhrkamp, Brief vom 16. August 1946, zit. n.:
Lernet-Holenia 1989, S. 650.
(11) Alexander Lernet-Holenia an Ernst Schönwiese, Brief vom 27. Feber 1947,
Nachlaß Ernst Schönwiese. Österreichisches Literaturarchiv der Österreichischen
Nationalbibliothek.
(12) Pein 1999, S. 249.
(13) Rüdiger Görner: In Kronos' austriakischem Gehöft. Etüde über Alexander Lernet-Holenias lyrisches Schaffen
(14) Alexander Lernet-Holenia an Ernst Schönwiese, Brief vom 27. Feber 1947, Nachlaß Ernst Schönwiese. Österreichisches Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek.
(15) Hölderlin o.J., S. 364.
(16) Vgl. Görner: In Kronos' austriakischem Gehöft.
(17) Pein 1999, S. 242.
(18) Lernet-Holenia 1996, S. 94f.
(19) Ebda., S. 324.
(20) Vgl. Lernet-Holenia 1997, S. 54, 56, 59.
(21) Lernet-Holenia 1948, S. 50.
(22) Ebda, S. 52f. Bei aller Kritik an den Österreichern zielt der Erzähler auch hier auf die Deutschen ab. Das Motiv des Parvenüs wird ähnlich wie in Germanien eingesetzt: »Niemand wird mir begreiflich machen, wie die Deutschen dem Einfluß eines Österreichers haben unterliegen können, der, wenn er bei uns selbst seine Karriere hätte beginnen wollen, über eine Anhängerschaft in Brunn am Gebirge und Maria-Lanzendorf niemals hinausgekommen wäre; niemand wird mir erklären, warum die Generäle den Befehlen des Gemeinen gehorcht haben, der Adel sich dem Unedlen gebeugt« (Ebda., S. 51).
(23) Ebda., S. 53.
(24) Pein 1999, S. 248.
(25) Vgl. ebda.
(26) Ebda., S. 245.
(27) Alexander Lernet-Holenia an Peter Suhrkamp, Brief vom 2. Oktober 1946, zit. in: Lerner-Holenia 1989, S. 651.
(28) Lernet-Holenia, Der Turm 1947. Vgl. Strigl 1998.
(29) Weinheber 1996, S. 411.
(30) Ebda., S. 413.
(31) Zit. in: anonym 1947, S. 210.
(32) Vgl. Alexander Lernet-Holenia an Ernst Schönwiese, Brief vom 17. Oktober 1947, Nachlaß Ernst Schönwiese. Österreichisches Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek.
(33) Weinheber 1956, S. 87.
(34) Ebda., S. 84.
(35) Ebda., S. 86.
(36) Ebda., S. 85.
(37) Vgl. Roõek 1997, S. 269.
(38) Kramer 1984, S. 399. Vgl. dazu Strigl 2000.
(39) Waldinger 1990, S. 94.
(40) Waldinger 1948, S. 409.
(41) Waldinger 1990, S. 109.
(42) Vgl. Auden 1975.
(43) Szabo 1947, S. 32.
(44) Vgl. Rocek 1997, S. 270-281.
(45) Vgl. Bekenntnis zu Josef Weinheber 1950.
(46) Alexander Lernet-Holenia an Peter Suhrkamp, Brief vom 19. Jänner 1946, zit. in:
Lernet-Holenia 1989, S. 650.
(47) Alexander Lernet-Holenia an Ernst Schönwiese, Brief vom 24. Dezember 1947,
Nachlaß Ernst Schönwiese. Österreichisches Literaturarchiv der Österreichischen
Nationalbibliothek.
(48) Szabo 1947, S. 45.
(49) Menasse 1990, S. 67.
(50) Pein 1999, S. 247f., vgl. S. 251f.
(51) Celan 1981, S. 7. Rüdiger Görner weist auf Lernets Parteinahme für Celan in Sachen Ästhetizismus-Vorwurf hin (Lernet-Holenia 2001, S. 104f); schon zuvor hat Lernet seinen Landsmann in der unseligen Plagiatsaffäre um Claire Goll öffentlich unterstützt. Vgl. dazu Paul Celan 2000, S. 320-325.
(52) Pein 1999, S. 248.
(53) Torberg 1981, S. 209 (Friedrich Torberg an Alexander Lernet-Holenia, Brief vom 15. Feber 1947).
(54) Pein 1999, S. 242.
(55) Vgl. ebda., S. 249.
(56) Görner (Anm. 13) hat auf Verbindungslinien zu T. S. Eliot aufmerksam gemacht.
(57) Vgl. Hölderlin o.J., S. 362, vgl. auch Kanton Schweiz, ebda., S. 130.
(58) Pein 1999, S. 248.
(59) Ebda., S. 242.
(60) Hölderlin o.J., S. 364.
(61) Görner (Anm. 13).
(62) Guttenbrunner 1999, S. 48.
(63) Torberg 1981, S. 204 (Friedrich Torberg an Alexander Lernet-Holenia, Brief vom 25. Mai 1946).
(64) Lernet-Holenia, Österreichisches Tagebuch 1947, S. 7.
(65) Vgl. Alexander Lernet-Holenia an Ernst Schönwiese, Brief vom 24. Dezember 1947, Nachlaß Ernst Schönwiese. Österreichisches Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek.
(66) Alexander Lernet-Holenia an Ernst Schönwiese, Brief vom 17. Oktober 1947, Nachlaß Ernst Schönwiese, Österreichisches Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek.
(67) Alexander Lernet-Holenia an Peter Suhrkamp, Brief vom 23. Juni 1946, zit. in: Lernet-Holenia 1989, S. 650.
(68) Vgl. Pein 1999, S. 249.
(69) Alexander Lernet-Holenia an Emil Lorenz, Brief vom 20. Feber 1947, zit. in: Lernet-Holenia 1989, S. 651.
(70) Alexander Lernet-Holenia an Ernst Schönwiese, Brief vom 27. Feber 1947, Nachlaß Ernst Schönwiese. Österreichisches Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek.
(71) Lernet-Holenia 2001, S. 72.
(72) Lernet-Holenia 1997, S. 60. Vgl. dazu Menasse 1990, S. 32, und Schmidt-Dengler 1995, S. 22.
(73) Vgl. Müller 2004.
(74) Torberg 1981, S. 201f. (Alexander Lernet-Holenia an Friedrich Torberg, Brief vom 21. Feber 1946).
(75) Alexander Lernet-Holenia an Felix Braun, Brief vom 7. August 1946, Nachlaß Felix Braun. Wiener Stadt- und Landesbibliothek.
(76) Huppert 1947, S. 6.
Literatur
Anonym (Tribüne der Jungen]: Wir und Josef Weinheber! In: Plan 1 (1947), H. 3, S. 210.
Auden, Wystan Hugh: Josef Weinheber (1892-1945). Deutsch von Wilhelm Szabo. In: Podium 5 (1975), H. 16, S. 6.
Bekenntnis zu Josef Weinheber. Erinnerungen seiner Freunde. Hrsg. von Heinrich Zillich. Salzburg 1950
Böhm, Gotthard: »Meine patriotische Tat«. »Presse«-Gespräch mit einem abermals zu entdeckenden österreichischen Romancier. In: Die Presse, 6.8.1971
Celan, Paul: Mohn und Gedächtnis. Gedichte. Stuttgart 1981
Csokor, Franz Theodor: Der fünfzigjährige Lernet-Holenia. In: Die Presse, 18.10.1947
Rüdiger Görner: In Kronos' austriakischem Gehöft. Etüde über Alexander Lernet-Holenias lyrisches Schaffen
Guttenbrunner, Michael: Vom Tal bis an die Gletscherwand. Reden und Aufsätze. Wien 1999
Huppert, Hugo: Einem, der auf Goldgrund schreibt... Offener Brief an Alexander Lernet- Holenia. In: Österreichisches Tagebuch 2 (1947), H. 27, S. 5f.
Hölderlin, Friedrich: Werke in 2 Bänden. Hrsg. von Günther Mieth. Bd. 1. Stuttgart o.J.
Kramer, Theodor: Gesammelte Gedichte in 3 Bänden. Hrsg. von Erwin Chvojka. Bd. 1. Wien/Zürich 1984.
Lernet-Holenia, Alexander: [Stellungnahme zu Weinheber]. In: Der Turm 2 (1947), H. 7, S. 234
Ders.: Zwischenwelt. In: Österreichisches Tagebuch 2 (1947), H. 28, S. 7
Ders.: Der Graf von Saint-Germain. Zürich 1948
Ders.: Das lyrische Gesamtwerk. Hrsg. von Roman Rocek. Wien/Darmstadt 1989
Ders.: Die Standarte. Roman. Wien 1996
Ders.: Die Lust an der Ungleichzeitigkeit. Redaktion: Thomas Hübel-Manfred Müller. Wien 1997
Ders.: Fragmente aus verlorenen Sommern. Gedichte. Ausgewählt und mit einem Nachwort von Rüdiger Görner. Wien 2001
Menasse, Robert: Die sozialpartnerschaftliche Asthetik. Essays zum österreichischen Geist. Wien 1990
Müller, Manfred: Ein Versuch, Staatsdichter zu sein. Alexander Lernet-Holenia 1945-1955. In: Bin ich denn wirklich, was ihr einst wart? Alexander Lernet-Holenia 1897-1976. Hrsg. von Thomas Hübel, Manfred Müller und Gerald Sommer. Riverside 2004
Paul Celan - Die Goll-Affäre. Dokumente zu einer »Infamie«, Hrsg. von Barbara Wiedemann. Frankfurt a.M. 2000
Pein, Michael: »Germanien« nach Auschwitz. Notwendige Anmerkungen zu Alexander Lernet-Holenias Lyrik seit 1945. In: Alexander Lernet-Holenia: Poesie auf dem Boulevard. Hrsg. von Thomas Eicher und Bettina Gruber. Köln u.a. 1999, S. 237-253
Rocek, Roman: Die neun Leben des Alexander Lernet-Holenia. Eine Biographie. Wien u.a. 1997
Strigl, Daniela: Worüber kein Gras wächst. Hans Leberts politische Lektion. In: Hans Lebert. Hrsg. von Gerhard Fuchs/Günther A. Höfler. Graz/Wien 1997 (= Dossier 12), S. 117-142.
Dies.: Spurensicherung auf dem »österreichischen NS-Parnaß«. Otto Basil und die Debatte um Josef Weinheber. In: Otto Basil und die Literatur um 1945. Tradition - Kontinuität - Neubeginn. Hrsg. von Volker Kaukoreit/Wendelin Schmidt-Dengler. Wien 1998 (= Profile. Magazin des Österreichischen Literaturarchivs 2), S. 66-76
Dies.: »Erschrocken fühl ich heut mich dir verwandt«. Theodor Kramer und Josef Weinheber. In: Chronist seiner Zeit. Theodor Kramer. Hrsg. von Herbert Staud/Jörg Thunecke. Klagenfurt 2000 (= Zwischenwelt 7), S. 255-274
Schmidt-Dengler, Wendelin: Bruchlinien. Vorlesungen zur österreichischen Literatur 1945 bis 1990. Salzburg 1995
Szabo, Wilhelm: Das Unbefehligte. Gedichte. München 1947
Torberg, Friedrich: In diesem Sinne. Briefe an Freunde und Zeitgenossen. München/Wien 1981
Waldinger, Ernst: Nicht Adel, aber Untergang. Betrachtungen zum Fall Weinheber. In: Plan 2 (1948), H. 6, S. 406-410
Ders.: Noch vor dem jüngsten Tag. Ausgewählte Gedichte und Essays. Hrsg. von Karl-Markus Gauß. Salzburg 1990
Weinheber, Josef: Sämtliche Werke in 5 Bänden. Hrsg. von Josef Nadler/Hedwig Weinheber. Bd. 5. Salzburg 1956
Ders.: Sämtliche Werke. Neu hrsg. von Friedrich Jenaczek. Bd. 3. Salzburg 1996